«Zersetzender Effekt auf die Moral»
Joseph E. Stiglitz ist Ende Mai im Rahmen des Swiss International Finance Forums (SIFF) als Schlussredner aufgetreten und hat dabei das Who is Who der Bankenszene nicht geschont. Im Interview mit HR Today spricht der zweifache Nobelpreisträger über fehlgeleitetes Design von Incentives, warum Frauen konservativer sind und formuliert seine Botschaft ans HR.
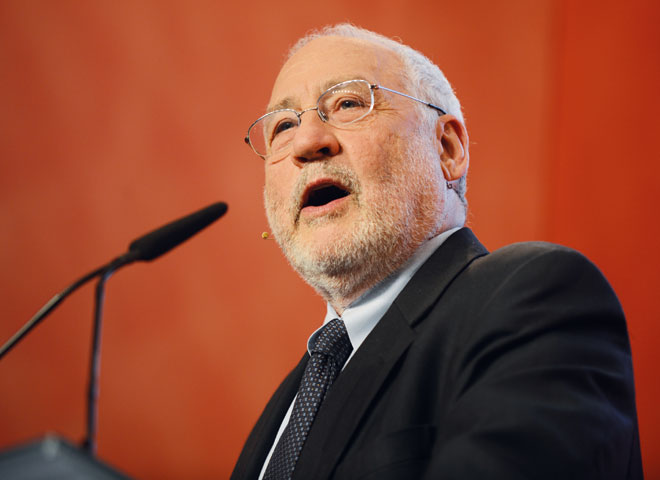
Joseph E. Stiglitz. (Foto: © SIFF 2014)
Herr Stiglitz, Sie haben in Ihrem Referat darauf hingewiesen, dass die Probleme im Finanzsektor damit zu tun haben, dass zu viel Gewicht auf die monetär getriebenen Anreize gesetzt wurde. Was können HR-Professionals daraus ableiten?
Joseph E. Stiglitz: Ein wichtiger Umstand, den jedes HR-Departement beachten sollte, ist der Grad der Ungleichheit, der in einem Unternehmen herrschen kann – egal, ob in den hohen oder tiefen Rängen. Und das HR sollte sich auch bewusst sein, welche Konsequenzen zu viel Ungleichheit haben kann. Nämlich einen zersetzenden Effekt auf die Moral. Ich habe das in meinem Buch «The Price of Inequality» thematisiert. Insbesondere in Bezug auf die angemessene Rolle monetär getriebener Incentives versus nicht-monetär getriebener Incentives. Ich meine, bei einem Herzchirurgen würden Sie ja auch nicht sagen: Wenn Sie hart arbeiten, gebe ich Ihnen einen Bonus. Er würde nicht in diesem Beruf arbeiten, wenn er sich nicht dazu verpflichtet hätte, den Job nach bestem Wissen und Gewissen auszuführen. Die Sache, dass man für gute Performance monetäre Anreize gibt, würde in diesem Fall als absurd betrachtet werden. Dennoch gibt es dieses Incentive-Element in vielen Berufen zu beobachten.
Ist der Finanzsektor dafür besonders anfällig?
Ich würde sagen, dass es im Finanzsektor eine ganze Reihe von Problemen gibt. Teil der Problematik war, dass die Bonus-Systeme mit kurzsichtigen Anreizen dazu ermutigten, Risiken einzugehen. Und wir sind noch lange nicht in einer ausreichend sicheren Situation. Das Problem hat mit dem Design der Incentives zu tun. Wenn man Dinge falsch angeht, etwa Mitarbeitende zu Diskriminierung ermuntert, sollten Konsequenzen drohen. Und auch wenn ein Vergehen erst ein, zwei oder drei Jahre später entdeckt wird, sollte der Verantwortliche immer noch dafür haften müssen – auch wenn der Betroffene das Unternehmen bereits verlassen hat. Die Unternehmen sollten also besser einen gewissen Anteil der Boni für fünf bis zehn Jahre zurückhalten und den Leuten klarmachen, dass sie nicht den vollen Betrag erhalten, wenn innert fünf Jahren ein Fehler entdeckt werden sollte.
Zur Person
Joseph E. Stiglitz (71) kam in Gary, Indiana (USA) zur Welt. Er promovierte 1967 am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Seine akademische Karriere führte ihn über Yale, Stanford, Oxford und Princeton an die Columbia University. Er arbeitete als Chefökonom der Weltbank und war Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsberater von US-Präsident Bill Clinton. 2001 erhielt er den Nobelpreis für seine Analysen von Märkten mit asymmetrischen Informationen. Zudem war er Hauptautor des Berichts des Weltklimarates, der 2007 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde.
Heute Morgen vor dem Live-Auftritt von Urs Rohner hier am Swiss International Finance Forum im Hotel Bellevue in Bern haben wir erfahren, dass die Credit Suisse in einem historisch anmutenden «Guilty», ihre Schuld eingestehen musste, verbunden mit einer Busse von über rund 2,5 Milliarden Dollar. Denken Sie, es war eine gute Entscheidung, dass die Köpfe an der Spitze des Unternehmens die gleichen geblieben sind?
Nun, der Punkt ist der, dass es nicht die Unternehmen, sondern die Shareholder sind, welche die Rechnung bezahlen, während Leute, die in den Businessaktivitäten engagiert sind, Boni davontragen und den Unternehmen damit substanzielles Kapital entziehen. Und sie können die Boni selbst auch noch dann behalten, wenn sie eines Vergehens überführt wurden.
Würden Sie soweit gehen, diesen Umstand als «Skandal» zu bezeichnen?
(überlegt) Ja das ist es, wenn solche Individuen keinerlei Konsequenzen fürchten müssen. Wissen Sie, die meisten Leute versuchen, ihr Bestes zu geben. Sie sind halt Teil eines Systems. Und ich versuche, dieses System zu betrachten. Und es gibt da in der Tat Leute, die sich nicht mehr spüren. – Aber die meisten dieser Leute haben Familie und Kinder. Und die wollen ihren Kindern kaum gestehen müssen, dass sie ihr Geld verdient haben, indem sie es den ärmsten Menschen gestohlen haben. Sie denken, sie seien mit sich im Reinen. Und sie denken manchmal nicht an alle Konsequenzen, die sich aus ihrem Tun ergeben.
Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass Sie solche Borderline-Aktivitäten vor allem bei Männern beobachten, was flugs Rückfragen aus dem Publikum provozierte. Sind die kritisierten Phänomene hauptsächlich bei Männern zu beobachten?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Das einzige, was ich zu bedenken geben wollte, ist, dass Studien existieren, die besagen, dass Frauen weniger spielfreudig sind. Vielleicht könnte man sogar sagen, dass sie konservativer sind. Frauen sind sicher sensibler für die Konsequenzen ihres Tuns. Auch für die moralischen Konsequenzen. Vielleicht ist es eine Generalisierung, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Evidenz für diesen Befund.
Brauchen wir in der Wirtschaft mehr Moral?
Zu versuchen, sich auf Kosten armer Menschen einen Vorteil herauszuschlagen, ist schlicht unmoralisch. Das ist auch der Grund, weshalb ich gegen jede Art von Diskriminierung eintrete. Es ist schlicht unmoralisch und es ist gegen das Gesetz.
Es ist bekannt, dass Sie während der Präsidentschaft von Bill Clinton leitender Wirtschaftsberater waren. Wie fühlt es sich an, Weltleader, wie den US-Präsidenten, persönlich zu beraten?
Sie übernehmen eine solche Aufgabe, weil Sie denken, etwas steuern und gewisse Dinge auch verändern zu können. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es in einem solchen Umfeld immer auch viele Leute, die in andere Richtungen steuern wollen. Nehmen Sie als Beispiel die Deregulierung im Finanzsystem. Ich habe vor solchen Gefahren gewarnt. Aber jene entgegneten damals nur: «Oh no»!
Haben Sie rückblickend den Eindruck, dass Sie als Berater etwas verändern konnten?
Ja, das denke ich schon. Aber es gibt eine enorm hohe Zahl von Leuten, die versuchen, auf den Präsidenten Einfluss zu nehmen. Man muss versuchen, ein Klima zu kreieren, welches erlaubt, dass gewisse Fakten bei ihm einsickern. Das ist ein langsamer Prozess. Es geht um Überzeugungsarbeit. Typischerweise in kritischen Momenten.
Was ist Ihre Botschaft an die HR-Professionals draussen in den Unternehmen?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich denke, dass das HR dafür da sein sollte, Menschen zu motivieren. Und wenn man Menschen motivieren will, geht es um weit mehr als nur um Geld. Es geht darum, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der die Leute wenigstens bis zu einem gewissen Grad Erfüllung erfahren können. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Die Menschen verbringen schliesslich den grössten Teil ihres Lebens in ihren Jobs. Das HR kann einen grossen Beitrag leisten, wenn es versucht, diesen Teil des Lebens sinnerfüllt zu gestalten.

