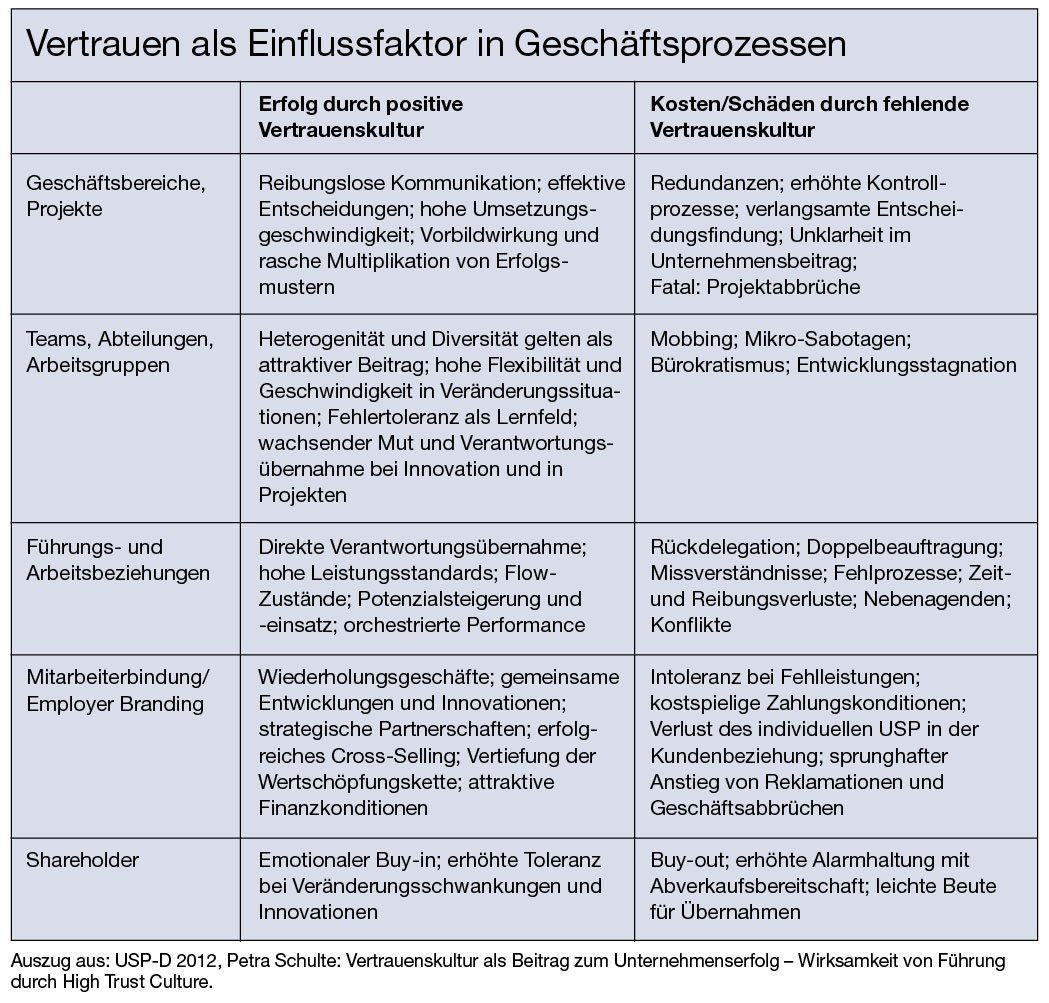Ist es also Sache der Führung, Vertrauen in einem Unternehmen zu etablieren?
Grundsätzlich schon. Die Führung schafft eine vertrauenfördernde Umgebung und lebt Vertrauen vor. Besonders entscheidend ist, wie viel Vertrauen den Mitarbeitern entgegengebracht wird. Entscheidend für eine Vertrauenskultur ist deshalb häufig das mittlere Management, die direkten Vorgesetzten. Sie haben einen Multiplikator-Effekt. Wenn sie respektvoll und höflich mit ihren Mitarbeitern umgehen, für Probleme ein offenes Ohr haben und einen Vertrauensvorschuss leisten, schöpfen Mitarbeiter leichter Vertrauen und verhalten sich auch eher vertrauensvoll. In den vergangenen Jahren wurde im Rahmen von Sparrunden oft auf den unteren und mittleren Management-Ebenen gespart. Das setzt viele Chefs unter Druck und geht mit verheerenden Konsequenzen für die Vertrauenskultur eines Unternehmens einher.
Welche Massnahmen helfen, um in einem Unternehmen eine Vertrauenskultur aufzubauen?
Zentral ist, dass die Chefs sich Zeit nehmen für ihre Mitarbeiter. Sie müssen Mitarbeitergespräche ernst nehmen und einen authentischen Führungsstil pflegen. Coaching ist ebenfalls ein sehr wichtiges Instrument. Der Coach sollte nicht nur auf der Beziehungsebene Hilfestellung leisten, sondern auch sachorientiert weiterhelfen können. Vertrauenfördernd ist auch das Leben einer guten Fehlerkultur. Zudem sollte die Delegation von Kompetenz und Verantwortung auf das Niveau des Mitarbeiters zugeschnitten sein. Möglichkeiten zur Mitarbeiterpartizipation sind ebenfalls wichtig. Nicht zu unterschätzen ist auch eine relative Jobsicherheit. In Krisenzeiten gibt es kreativere Lösungsansätze, als einfach gleich Stellen zu streichen.
Heisst Vertrauen auch, Kontrollen abzuschaffen?
Nein, ganz und gar nicht. Ein Vertrauenssystem funktioniert nicht ohne Kontrollen, alleine schon deshalb, weil Trittbrettfahrer sonst leichtes Spiel haben und sich die engagierten Mitarbeiter als gutmütige Trottel fühlen würden. Studien belegen, dass eine Vertrauenskultur fairer ist, wenn klare Strukturen vorgegeben sind, an die man sich halten muss. Zudem hilft Kontrolle auch, Schwachstellen früh zu entdecken und Hilfeleistungen anzubieten.
Was kann das HR zu einer guten Vertrauenskultur beitragen?
Die neue Forschung zeigt, dass das Bewerbungsgespräch als Erstkontakt sehr prägend ist. Dort schätzt der Bewerber ein, wie sehr er dem Unternehmen oder den Vorgesetzten vertrauen kann. Vorerst wird er diese Meinung sehr wahrscheinlich nicht gleich wieder ändern. Zudem: Wenn Teams im Arbeitsalltag eine wichtige Rolle spielen, sollte das Team das letzte Wort bei der Personalauswahl haben.
Wie viel kostet eine Vertrauenskultur?
Wenn von Grund auf, sagen wir aus einer neutralen Struktur, eine Vertrauenskultur geschaffen werden muss, kann das schon kosten. Es geht hier, wie vorher angesprochen, zum Beispiel um das mittlere Management, das vorhanden sein sollte und genügend Zeit braucht für die Mitarbeiter. Dazu kommen Massnahmen, die nicht direkt mit Vertrauen zu tun haben, aber eine vertrauenswürdige Botschaft an die Mitarbeiter vermitteln: Wir kümmern uns um dich und nehmen deine Bedürfnisse ernst. Entsteht ein solches Gefühl beim Mitarbeiter, steigt sein Vertrauen. Ein Beispiel dafür ist die Schaffung von familienfreundlichen Strukturen. Solche Strukturen können Kosten mit sich bringen, helfen aber auch, Berufsalltag und Elternschaft unter einen Hut zu bringen. Eine solche Massnahme wird von vielen Mitarbeitern geschätzt und mit Vertrauen belohnt.
Zahlt sich das aus? Sind Unternehmen mit einer Vertrauenskultur wirtschaftlich erfolgreicher?
In der Forschung ist man sich nicht einig. Es gibt nur vereinzelt Studien, die zeigen, dass Vertrauen die Unternehmensperformance erhöht. Allerdings wissen wir, dass sich Vertrauen positiv auf die Mitarbeiterproduktivität auswirkt. Zudem trägt Vertrauen auch indirekt zum Unternehmenserfolg bei. Wer Vertrauen hat, zeigt eine höhere Lernbereitschaft, ist motivierter, teilt sein Wissen und leistet mehr als nur Dienst nach Vorschrift. All diese Faktoren sind enorm wichtig für Innovation und Wissensaufbau.
Wie kann man Vertrauen messen?
Vertrauen lässt sich gut in Mitarbeiterbefragungen messen. Es korreliert oft mit weniger Kündigungen, weniger Fehlzeiten und weniger Abgang von Talenten – es lohnt sich also in Anbetracht der menschlichen Aspekte. Und: Menschen, die misstrauisch sind, werden sogar häufiger enttäuscht als vertrauensvolle.
Die Rolle des HR in einer Vertrauenskultur
Verschiedene Autoren schreiben dem Human Resource Management bei der Etablierung einer Vertrauenskultur im Unternehmen eine wichtige Rolle zu. Nicht nur die Massnahmen selbst, sondern auch die Art der Durchsetzung ist für die Mitarbeiter bei der Vertrauensbildung entscheidend. Dabei sind die HR-Verantwortlichen in der schwierigen Situation, zwischen Management und Personal eine Art Vermittlerrolle einzunehmen. Obwohl das HR in seinen Kernelementen für vertrauensbildende Arbeitsmodelle einsteht, sind paradoxerweise oft HR-Verantwortliche die ausführende Kraft bei vertrauenschädigenden Massnahmen wie beispielsweise Entlassungen.
Schon in der frühen Forschung zum Thema HR und Vertrauensbildung wurde eine Korrelation zwischen dem Vertrauen der Mitarbeiter in das Management und die Organisation und fairen, präzisen HR-Praktiken nachgewiesen. Ebenfalls wissenschaftlich untersucht wurde die Rolle von sogenannten High-involvement-Systemen für die Vertrauensbildung. Arbeitsmodelle also, bei denen Wert auf einen guten Kommunikationsfluss, Empowerment und Partizipation gelegt wird. Bei Mitarbeitern, die in solchen Strukturen arbeiten, wurde mehr Vertrauen und Commitment, grössere Arbeitszufriedenheit und weniger Stressempfinden festgestellt. HRM-Strategien können auch die Wahrnehmung der Vertrauenswürdigkeit einer Organisation beeinflussen. Zum Beispiel sig-nalisiert Jobsicherheit Wohlwollen und Fürsorge des Unternehmens gegenüber seinen Mitarbeitern. Familienfreundliche Massnahmen suggerieren ein Interesse des Unternehmens am Wohlbefinden der Mitarbeiter.
Eine weitere Art, die Beziehung zwischen HRM und Vertrauen zu analysieren, ist der sogenannte psychologische Vertrag, den Mitarbeiter mit dem Unternehmen eingehen. Beispielsweise indizieren mehr HR-Regeln, dass mehr Abmachungen getroffen wurden, an die sich beide Seiten halten. Somit besitzt HRM eine grosse Bedeutung für die Entwicklung von Vertrauen neuer Mitarbeiter: Findet ein neuer Mitarbeiter klare Strukturen vor, schafft das eine gute Vertrauensbasis.
- Quelle: Rosalind Searle, Antoinette Weibel, Deanne N. Den Hartog: Employee Trust in Organizational Contexts. In: Gerard P. Hodgkinson, J. Kevin Ford: International Review of Industrial and Organizational Psychology 2011, Vol. 26.