Fallstricke bei der krankheitsbedingten Auflösung des Arbeitsvertrages
Wenn ein Arbeitnehmer aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, seinen arbeitsvertraglichen Pflichten nachzukommen, stellt sich für den Arbeitgeber notgedrungen die Frage nach der Auflösung des Arbeitsvertrages.
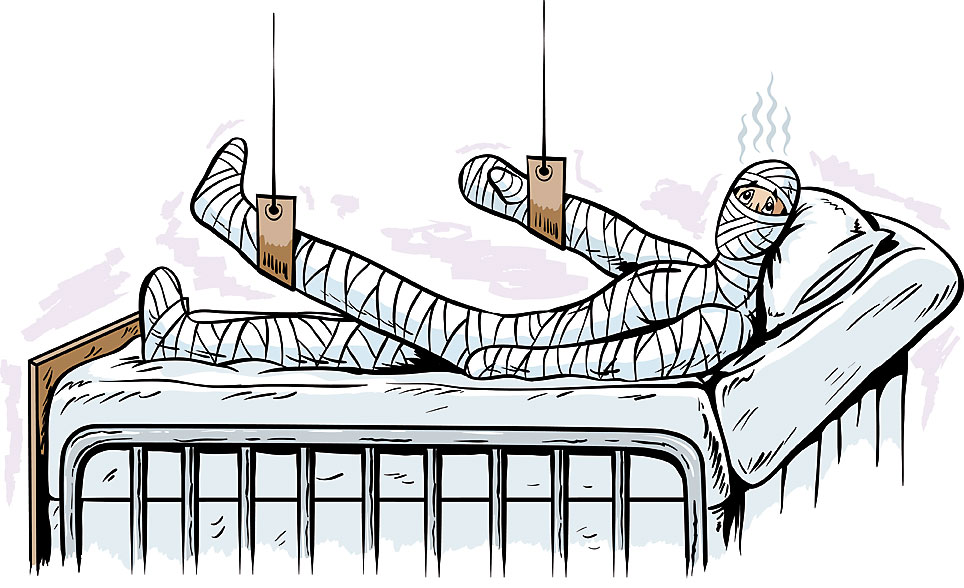
(Foto: iStockphoto)
Unter welchen Umständen darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis im Spannungsfeld des krankheitsbedingten Kündigungsschutzes beenden? Die nachfolgende Auslegeordnung befasst sich mit den allgemeinen Problemkreisen und zeigt auf, dass der Arbeitnehmerschutz im Schweizer Arbeitsrecht zu Recht keine absolute Geltung beansprucht.
Umstände einer sogenannten Unzeit, in der Kündigung nicht möglich ist
Das Gesetz enthält in Art. 336c OR einen abschliessenden Katalog von Umständen, welche die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber nach Ablauf der Probezeit vorübergehend verunmöglichen. Krankheit und Unfall stellen nebst Militär- oder Zivildienst, dem Einsatz bei Hilfs aktionen im Ausland sowie Mutterschaft Umstände der sogenannten Unzeit dar. Eine vom Arbeitgeber zur Unzeit ausgesprochene Kündigung ist nichtig. Sie erlangt auch dann keine Gültigkeit, wenn der Arbeitnehmer wieder zur Arbeit erscheint.
Die zur Unzeit mitgeteilte Kündigung muss deshalb nach Wegfall des Sperrgrundes erneut ausgesprochen werden, mit der Konsequenz, dass die Kündigungsfrist entsprechend erst ab dem Zeitpunkt der rechtsgültigen Mitteilung zu laufen beginnt. Damit der Arbeitgeber im Falle andauernder Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers gleichwohl handlungsfähig bleibt, hat der Gesetzgeber die Kündigungssperre zeitlich begrenzt, und zwar im ersten Dienstjahr auf 30 Tage, ab dem zweiten bis und mit fünften Dienstjahr auf 90 Tage und ab dem sechsten Dienstjahr auf 180 Tage.
Der Einfachheit halber darf der Arbeitgeber das Dienstjahr vertraglich durch das Kalenderjahr ersetzen, da für den Arbeitnehmer hiermit eine gleichwertige Lösung angestrebt wird. Ist die sogenannte Sperrfrist einmal verstrichen, steht der Auflösung des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nichts mehr im Wege. Es gilt indes darauf hinzuweisen, dass unterschiedliche Verhinderungsgründe gemäss der Praxis des Bundesgerichts verschiedene Sperrfristen auslösen können, sofern diese untereinander in keinem Zusammenhang stehen. Folglich kann es vorkommen, dass eine Lungenentzündung gefolgt auf einen Beinbruch zweimal eine Sperrfrist auslöst, während bei einer Lungenentzündung, welche sich aus einer schweren Erkältung entwickelt hat, die Anzahl Krankheitstage kumuliert werden.
Ist der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Kündigung gesund und erkrankt er erst während der Kündigungsfrist, wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. Dies hat zur Folge, dass sich das Arbeitsverhältnis um die effektive Dauer der Arbeitsverhinderung verlängert. Da Arbeitsverhältnisse in der Praxis üblicherweise per Ende Monat enden, verschiebt sich die tatsächliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses somit zusätzlich.
Kein Kündigungsschutz bei schwerem Eigenverschulden
Keinen Schutz gewährt der Gesetzgeber im Falle grobfahrlässig oder vorsätzlich selbstverschuldeter Unfälle oder Krankheiten. Im Zusammenhang mit einer Krankheit wäre dies beispielsweise bei einer Behandlungsverweigerung denkbar. Wer sich freiwillig einer Schönheitsoperation unterzieht, wird sich auch dann nicht auf einen Sperrgrund berufen können, wenn die Heilung weniger gut voranschreitet als erwartet. Liegt hingegen ein medizinischer Kunstfehler vor, ist die Situation neu zu beurteilen. Ebenfalls kein Fall von Kündigung zur Unzeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer aufgrund eines durch Alkohol am Steuer verursachten Unfalls von der Arbeit fernbleibt oder er bei einem Streit ein Messer zieht und sich dabei verletzt. Unterzieht sich der Arbeitnehmer hingegen einem medizinischen Eingriff, welcher zwar hätte verschoben werden können, aber dennoch notwendig war, entzieht sich der Arbeitnehmer seiner Schuld. Es bleibt anzumerken, dass die Beweispflicht für das Vorliegen der Unzeit begründenden Umstände dem Arbeitnehmer obliegt und dieser darüber hinaus verpflichtet ist, den Arbeitgeber unverzüglich über seinen Zustand in Kenntnis zu setzen.
Keine Sperrfristen bei fristloser Entlassung
Im Krankheitsfall stellt die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Erbringung der Arbeitsleistung ausdrücklich keinen Grund zur ausserordentlichen Kündigung dar (Art. 337 Abs. 3 OR). Liegen jedoch zusätzlich andere Umstände vor, welche die Fortführung des Arbeitsvertrages, unabhängig vom Gesundheitszustand des Arbeitnehmers, gesamthaft als unzumutbar erscheinen lassen, kann das Arbeitsverhältnis aus wichtigen Gründen auch bei andauernder Krankheit des Arbeitnehmers fristlos aufgelöst werden. Als wichtiger Grund gilt dabei jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden darf.
Kündigung wegen Krankheit kann missbräuchlich sein
Laut Gesetz ist die Kündigung unter anderem missbräuchlich, wenn sie aufgrund persönlicher Eigenschaften ausgesprochen wird, es sei denn, die Eigenschaft steht in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder sie beeinträchtigt wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb (Art. 336 Abs. 1 lit. a OR). Krankheiten zählen zu diesen persönlichen Eigenschaften. Sie eignen sich daher vorderhand nur dann als Kündigungsgrund, wenn sich die mit der Krankheit einhergehende Absenz anderweitig negativ auf die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Leistungspflicht auswirkt oder die Zusammenarbeit im Betrieb sonst wie wesentlich beeinträchtigt wird. Im Zweifelsfalle empfiehlt es sich, die Rechtmässigkeit eines mit dem Gesundheitszustand in Zusammenhang stehenden Kündigungsgrundes juristisch abklären zu lassen.
Aufhebungsvereinbarung als Mittel zur Lösung?
Nebst der einseitigen Vertragsauflösung können sich die Vertragsparteien im beidseitigen Einvernehmen jederzeit von ihren vertraglichen Pflichten entbinden. Sperr- und Kündigungsfristen sind jedoch Teil des zwingenden Rechts. Es wäre deshalb denkbar, dass ein Gericht diese auch im Falle der sofortigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses zur Anwendung bringt. Will sich der Arbeitgeber gegen dieses Risiko absichern, sollte der Arbeitnehmer in der Aufhebungsvereinbarung wirtschaftlich oder durch gleichwertige, nicht wirtschaftlich motivierte Vorteile der ordentlichen Kündigung gleichgestellt sein.

