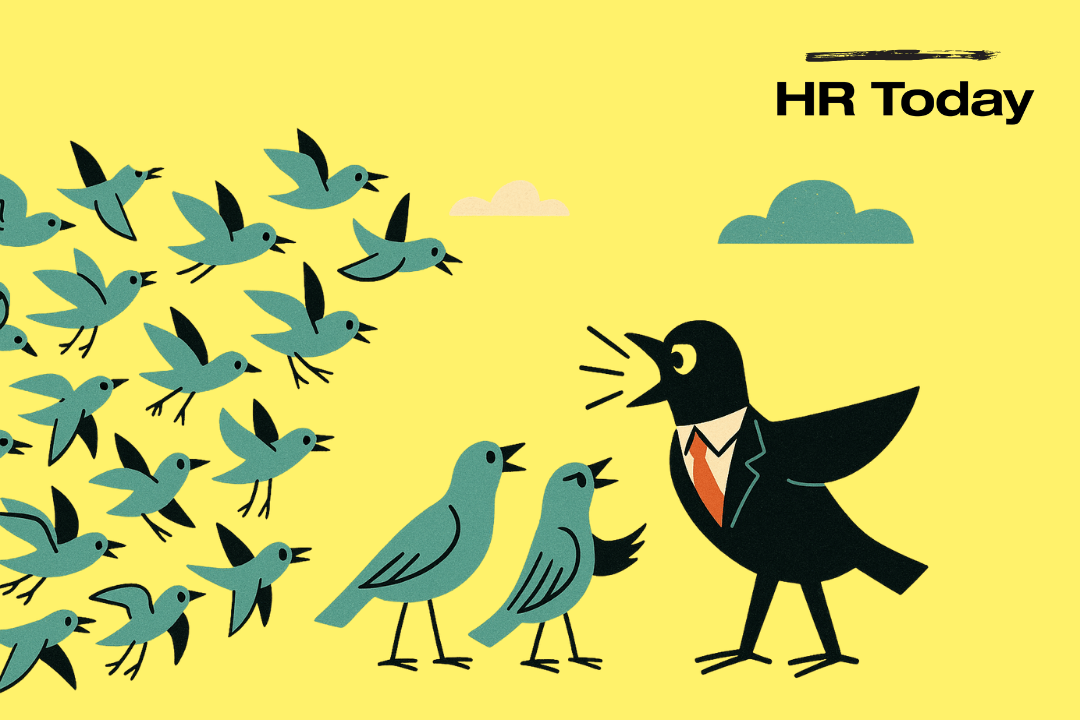Geführte Selbstorganisation – ein Paradoxon mit Zukunft
Selbstorganisation ohne Chaos – geht das? Ein Erfahrungsbericht über Haltung, Struktur und die Rolle von «People and Culture» am Beispiel der CSP AG Competence Solutions Projects.

Nicht alle Menschen blühen auf, wenn es um Selbstorganisation geht. (Bild: ChatGPT)
Am Anfang standen eine Idee und eine leise Unsicherheit: «Lasst uns zur Selbstorganisation entwickeln. Aber: Können wir wirklich auf Hierarchien verzichten, ohne im Chaos zu versinken?»
Heute wissen die Mitarbeitenden der CSP AG (Competence Solutions Projects): Ja, wir können. Aber nicht ohne Struktur, nicht ohne Führung und vor allem nicht ohne Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu tragen. Der Beitrag zeigt am Beispiel einer Unternehmensberatung, wie «die geführte Selbstorganisation» in der Praxis funktionieren kann, welche Menschen darin aufblühen – und warum HR dabei eine Schlüsselrolle spielt.
Warum Selbstorganisation?
Lange war die CSP eine klassisch hierarchisch geprägte Unternehmensberatung mit Team- und Regionenverantwortungen. Ein vertrautes Organisationsmodell – bis die Realität der Märkte und Menschen dieses Modell zunehmend in Frage stellte. Was die Zukunft verlangte, passte nicht mehr zur gewohnten Form: beschleunigter Wandel, stärkerer Innovationsdruck, neue Arbeitskulturen, fluide Kundenbedürfnisse und Generationen, die nicht nur arbeiten, sondern stärker mitgestalten wollen. Der Wandel war unausweichlich, und er kam konsequent und durchdacht: als «Big Bang» in Richtung geführter Selbstorganisation.
Der Entscheid für diesen Schritt war das Ergebnis einer strategischen Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunftsfähigkeit – und mit Theorien, die den Menschen ins Zentrum stellen. Besonders prägend war das Modell von Daniel Pink, das intrinsische Motivation als Zusammenspiel von
Relatedness, Mastery, Autonomy und Purpose beschreibt:
- Relatedness, das Erleben von Verbundenheit, schafft den sozialen Boden, auf dem Selbstorganisation gedeihen kann – durch Vertrauen, Zugehörigkeit und gemeinsame Verantwortung.
- Mastery, das Streben nach fachlicher Tiefe, ist für CSP als Expertenorganisation identitätsstiftend – die Mitarbeitenden wollen gestalten, vertiefen und verstehen.
- Autonomy wirkt als Katalysator: Wer selbst entscheidet, wie er arbeitet, erlebt Selbstwirksamkeit – und entfaltet neue Energie.
- Purpose zeigt sich am Beitrag zum grossen Ganzen: Neue Mitarbeitende wirken von Anfang an mit – nicht Status, sondern Engagement zählt.
CSPstars – ein Framework für geführte Selbstorganisation
Die CSP agiert nun seit bald fünf Jahren als geführte Selbstorganisation – mit ihrem eigens dafür entwickelten Modell «CSPstars». Der Begriff «stars» steht dabei als Akronym für: selbstorganisiert, teamorientiert, agil, resilient und smart. Das Modell schafft Orientierung in der Zusammenarbeit und hält zugleich genug Freiraum offen, damit Menschen Verantwortung übernehmen und ihr Potenzial entfalten können.
Die Eckpunkte des Modells wurden aus unterschiedlichen Konzepten entlehnt und gezielt auf die Kultur und das Selbstverständnis von CSP abgestimmt. Die Entwicklung des Frameworks «CSPstars» erfolgte über einen längeren Zeitraum und in mehreren Iterationen – stets mit dem Anspruch, Selbstorganisation und unternehmerisches Denken im Sinne der Gesamtorganisation zu verbinden. Dabei dienen die Unternehmensstrategie und die übergeordneten Ziele als Kompass. Roger Künzli, Mitglied der Geschäftsleitung, bringt es auf den Punkt: «Der geführte Teil definiert das ‹Was›: Strategie, Ziele, Leitplanken. Das ‹Wie› liegt in der Verantwortung der Organisationseinheiten.»
Wie kann Selbstorganisation geführt sein?
Es klingt widersprüchlich, aber genau das macht es spannend. Es meint: Menschen arbeiten eigenverantwortlich, aber innerhalb klarer Leitplanken und mit Orientierung durch gemeinsame Ziele. CSP setzt dabei auf ein bewusst gestaltetes Zusammenspiel verschiedener Ebenen – von der Haltung bis zur täglichen Umsetzung:
- Eine normative Ebene bildet das kulturelle Fundament der Organisation – so etwas wie ihr Herzschlag. Ein gemeinsam entwickelter Wertekompass und ein klar formulierter Kodex definieren, wie Zusammenarbeit gelingen soll.
- Die Organisationsverfassung übersetzt diese Werte in konkrete Spielregeln. Sie schafft Verbindlichkeit im Umgang miteinander, regelt Entscheidungsprozesse und macht transparente Kommunikation zum Standard.
- Die operative Struktur basiert auf Circles, also marktbezogenen Einheiten, in denen Teams eigenverantwortlich handeln. Jeder Circle ist für seinen Bereich zuständig – von der Akquise über die Leistungserbringung bis hin zum Recruiting. Ergänzt wird das Modell durch Einheiten, die fachlichen Austausch und übergreifende Koordination ermöglichen.
- Damit neue Mitarbeitende schnell in Kultur und Struktur ankommen, gibt es ein modulares Onboarding, unterstützt durch ein digitales Lernmanagementsystem (LMS). Ergänzt wird dies durch eine persönliche Begleitung – die Rolle von Gottis oder Göttis, die fachlich wie kulturell Orientierung geben.
So entsteht eine lernende Organisation, die sowohl klare Verortung als auch Raum zur Entfaltung bietet.
Für wen eignet sich die geführte Selbstorganisation?
In den letzten Jahren hat sich bei CSP deutlich gezeigt: Es gibt einen bestimmten Menschentyp, der besonders gut in einer selbstorganisierten Umgebung mit klaren Führungsimpulsen gedeiht. Drei Eigenschaften sind dabei zentral:
- Intrinsische Motivation und hohe Maturität: Menschen, die aus sich heraus motiviert sind und eigenverantwortlich handeln, kommen mit einem hohen Mass an Freiheit besonders gut in der geführten Selbstorganisation zurecht. Sie brauchen keine ständige Anleitung, sondern nutzen Freiräume konstruktiv.
- Gestaltungswille und Umsetzungskraft: Wer gern Verantwortung übernimmt, Ideen entwickelt und mit Elan umsetzt, bringt die nötige Energie mit, um in einer dynamischen Organisation Wirkung zu entfalten.
- Selbstmanagement und Resilienz: Selbstorganisation funktioniert nur mit einem guten Gefühl für die eigenen Grenzen, einem gesunden Mass an Selbstreflexion und der Fähigkeit, sich selbst wirksam zu steuern – auch unter Belastung. Nicht alle Mitarbeitenden starten mit denselben Voraussetzungen, was in Ordnung ist. Geführte Selbstorganisation ist kein Ausschlusskriterium, sondern ein Entwicklungsweg. Mit klarer Orientierung, Unterstützung und Lernbereitschaft können auch andere in diese Rolle hineinwachsen. Vielfalt bleibt dabei eine wichtige Stärke.
Herausforderungen und Spannungsfelder
Damit Selbstorganisation im Alltag funktioniert, braucht es Klarheit, Transparenz, Haltung und die Bereitschaft, Verantwortung wirklich zu leben. Da ist kein Chef, der müden Mitarbeitenden auf die Schulter klopft und sagt: «Jetzt hast du drei Wochen Vollgas bis in die Nacht gebügelt, bitte mach mal eher Schluss.» Diese Fürsorge muss in erster Linie von der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter selbst kommen. Denn im freien Setting mit selbstständiger Zeit- und Ortswahl sieht man sich oft weniger – und Führung im klassischen Sinn tritt in den Hintergrund. Umso wichtiger ist es, dass Mitarbeitende Instrumente an die Hand bekommen, mit denen sie die Selbstwirksamkeit erleben, ihre Belastung reflektieren, Bewältigungsstrategien entwickeln und so ihre Resilienz stärken können.
Auch unklare Schnittstellen stellen eine wiederkehrende Herausforderung dar:
- Wer trägt die Verantwortung für eine Entscheidung?
- Wer kommuniziert?
- Welche Themen müssen noch durch die Geschäftsleitung?
Gerade für die Geschäftsleitung bedeutet das ein ständiges Umlernen: sich bei Entscheidungen bewusst zurückzunehmen, Macht zu teilen, Vertrauen auszusprechen – und dabei die kollektive Intelligenz zu nutzen. Denn genau dort liegt der Mehrwert: in der geteilten Verantwortung und der Stärke des Schwarms. Dabei gilt es, die Balance zu halten zwischen Loslassen und dem Anspruch, das Unternehmen weiterhin klar und erfolgreich weiterzuentwickeln – ein Spagat, der einiges an Führungskompetenz und Selbstreflexionsfähigkeit erfordert.
Um diesen Wandel wirkungsvoll zu begleiten und die kollektive Intelligenz in der Organisation zu entfalten, braucht es eine Funktion, die Brücken baut, Prozesse gestaltet und Kulturarbeit leistet – hier kommt HR als Transformationsgestalter ins Spiel.
People and Culture als Transformationsgestalter
In einer geführten Selbstorganisation wandelt sich die Rolle des HR vom operativen Dienstleister hin zu einem strategisch integrierten, kulturprägenden Akteur. Mit dieser Ausrichtung trägt es das treffende Label «People and Culture» und agiert als Coach, Enabler und Business Partner entlang des gesamten Employee Lifecycle mit Fokus auf Candidate Journey, Onboarding Experience, Retention und People Development. Ziel ist es, berührende und wirksame Touchpoints zu schaffen, die auf die Performance und Kultur einzahlen – sowohl im Recruiting als auch im Arbeitsalltag.
People and Culture wird dabei als Organisationsentwicklungsfunktion mit einer starken Servant-Leadership-Orientierung gesehen. Es wird in unserer Organisation unter anderem durch die Rolle People Operations wie auch die Unit People and Culture gelebt. Sie sind Impulsgeber für eine Kultur, in der Selbstverantwortung, psychologische Sicherheit und Lernorientierung gezielt gefördert werden. Der Schwerpunkt liegt auf systemischer Transformationsarbeit und Empowerment.
Wenn Verantwortung geteilt, Vertrauen gelebt und Kultur bewusst gestaltet wird, entsteht mehr als ein neues Organisationsmodell – es entsteht Zukunftsfähigkeit.