Wie Schweizer Unternehmen eine neue Innovationskultur im Alltag verankern
Tischtennisplatten, Post-it-Wände und kreative Labore waren gestern: Erfolgreiche Schweizer Unternehmen fördern Innovation durch echte Mitsprache, Vertrauen und strukturelle Veränderungen.

Pingpong-Tische und Post-it-Zettel machen noch lange keine Innovation. (Bild: ChatGPT / Canva)
«Wir wollten Innovation, bekommen haben wir Post-its.» Solche Aussagen machten in den letzten Jahren die Runde, wenn es ums Thema Ideen und Innovation ging. Pingpong-Tisch, Kreativlab, Post-it-Wände - viele Unternehmen haben es versucht. Und viele sind ernüchtert: «We tried, didn’t work.» Aber was, wenn es doch funktioniert, nur anders als gedacht?
Die Arbeitswelt von heute stellt Organisationen und Mitarbeitende vor ständig wachsende Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung, multiple Krisen, Kultur- und Wertewandel – und das alles in ständig zunehmendem Tempo. Ziel von Organisationen und Mitarbeitenden ist es, mit diesen Herausforderungen nicht nur Schritt zu halten, sondern sie mit Erfolg zu meistern.
Innovation als Teil des Arbeitsalltags?
Die Möglichkeit, im Arbeitsalltag Ideen einzubringen, hat in den letzten zehn Jahren in der Schweiz deutlich zugenommen. Drei von fünf Arbeitnehmenden bewerten diesen Aspekt heute besser als vor fünf Jahren, so die repräsentative Avenir Arbeitsmarktstudie vom Februar 2025. Das sind gute Neuigkeiten: für Organisationen, die von Optimierungen profitieren, und für Mitarbeitende, die sich dadurch weiterentwickeln können.
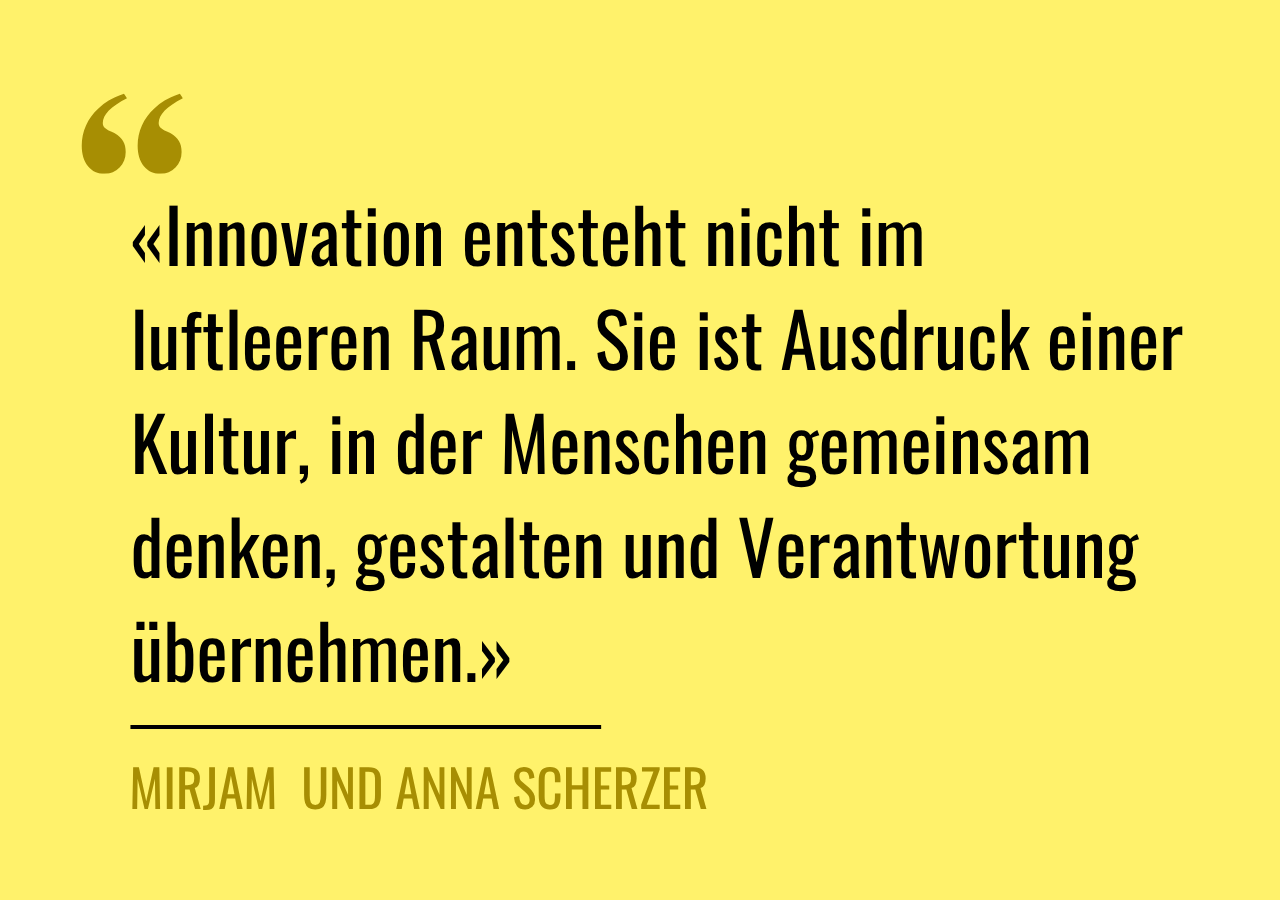
Diese Entwicklung am Arbeitsmarkt ist bemerkenswert, gerade weil sich andere Themen in der Studie kaum verändert haben. Was hat sie ausgelöst und wird sie nachhaltig bleiben? Eine mögliche Erklärung: Arbeitgebende reagieren stärker auf den Wunsch der jungen Generation nach mehr Mitsprache und Mitgestaltung. Doch das greift zu kurz. Denn bei anderen Themen, die dieser Generation wichtig sind – etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben –, zeigt sich keine vergleichbare Verbesserung. Das spricht für einen anderen Auslöser: die Corona-Pandemie. Der plötzliche Druck, schnell und kreativ zu handeln, hat viele Organisationen dazu gebracht, neue Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln. Wer diese beibehalten hat, profitiert bis heute von kürzeren Innovationszyklen und mehr unternehmerischem Denken bei den Mitarbeitenden. Doch nicht alle Organisationen sind Teil dieser «Innovationswelle». Die Ergebnisse der Studie zeigen grosse Unterschiede bei den Schweizer Arbeitgebenden. Nur rund ein Drittel der Befragten erlebt beim eigenen Arbeitgeber gute Voraussetzungen für Innovation, die meisten bleiben in alten Mustern stecken.
Was erfolgreiche Unternehmen anders machen
Innovative Organisationen schaffen gezielt Strukturen, die Zusammenarbeit nicht nur ermöglichen, sondern im Alltag unterstützen. Dabei reicht es nicht, digitale Tools bereitzustellen, Hierarchien zu reduzieren oder einen Pingpong-Tisch anzuschaffen. Entscheidend ist, wie Verantwortung verteilt, Austausch gestaltet und Vielfalt genutzt wird.
Einfache Tipps für die
Innovationsförderung
Drei kleine Dinge, die Sie morgen tun können:
- Fragen Sie eine Person aus dem Team spontan: «Was würdest du ändern, wenn du für einen Tag Chefin oder Chef wärst?» Diese Frage bringt oft überraschend konstruktive Ideen und zeigt, wie Mitarbeitende ihre Wirkung sehen.
- Laden Sie bewusst jemanden ins Team-Meeting ein, der nicht dazugehört – zum Beispiel eine Person aus einem anderen Team, einer anderen Generation oder mit anderer Funktion – und holen Sie ihre Sicht auf ein aktuelles Thema ab. Das bringt frische Denkanstösse, durchbricht Silos und macht Vielfalt im Alltag nutzbar.
- Wählen Sie ein konkretes Problem aus Ihrem Alltag, zum Beispiel einen ineffizienten Prozess oder eine wiederkehrende Kundenreklamation, und holen Sie zwei Mitarbeitende ins Boot, um innerhalb von zehn Tagen eine Lösung zu entwerfen.
Konkret wurde in der Arbeitsmarktstudie von Avenir untersucht, was Organisationen anders machen, deren Mitarbeitende sagen, dass sie schnell auf Veränderungen in ihrem Umfeld reagieren, bei denen das Teilen von Wissen zum Alltag gehört, Ideen eingebracht werden können und Fehler als Chance zum Lernen und Verbessern gelten. Solche Organisationen differenzieren sich deutlich von ihren Mitbewerbern durch ihre Führungskultur, ihre Informationspolitik, das Strategieverständnis in der Belegschaft, den Einbezug und den Handlungsspielraum von Mitarbeitenden sowie die Art und Weise, wie in Teams und über Teamgrenzen hinweg zusammengearbeitet wird.
Diese Themen werden auf der 100er-Skala bei den Innovations-Champions von jedem Mitarbeitenden um 30 bis 40 Punkte besser beurteilt als von Mitarbeitenden in innovationsschwachen Organisationen. Und das lohnt sich: Arbeitgebende mit Innovationskultur profitieren entsprechend von einfacheren Prozessen und stärkerer Mitarbeitendenbindung. Und auch für Mitarbeitende zahlt es sich aus, denn sie lernen Neues dazu und entwickeln ihre Fähigkeiten weiter.
Führungsrolle im Wandel
Die Führungsrolle wird anspruchsvoller, wenn ein innovatives Umfeld geschaffen werden soll: Statt einfacher Zielvorgaben geht es darum, zudem als Coach und Vernetzer zu agieren. Das heisst, das grosse Ganze im Blick zu behalten und gleichzeitig die psychologische Sicherheit im Team zu stärken. Denn nur wer sich sicher fühlt, bringt Ideen – und vor allem unbequeme oder kontroverse Ideen – ein.
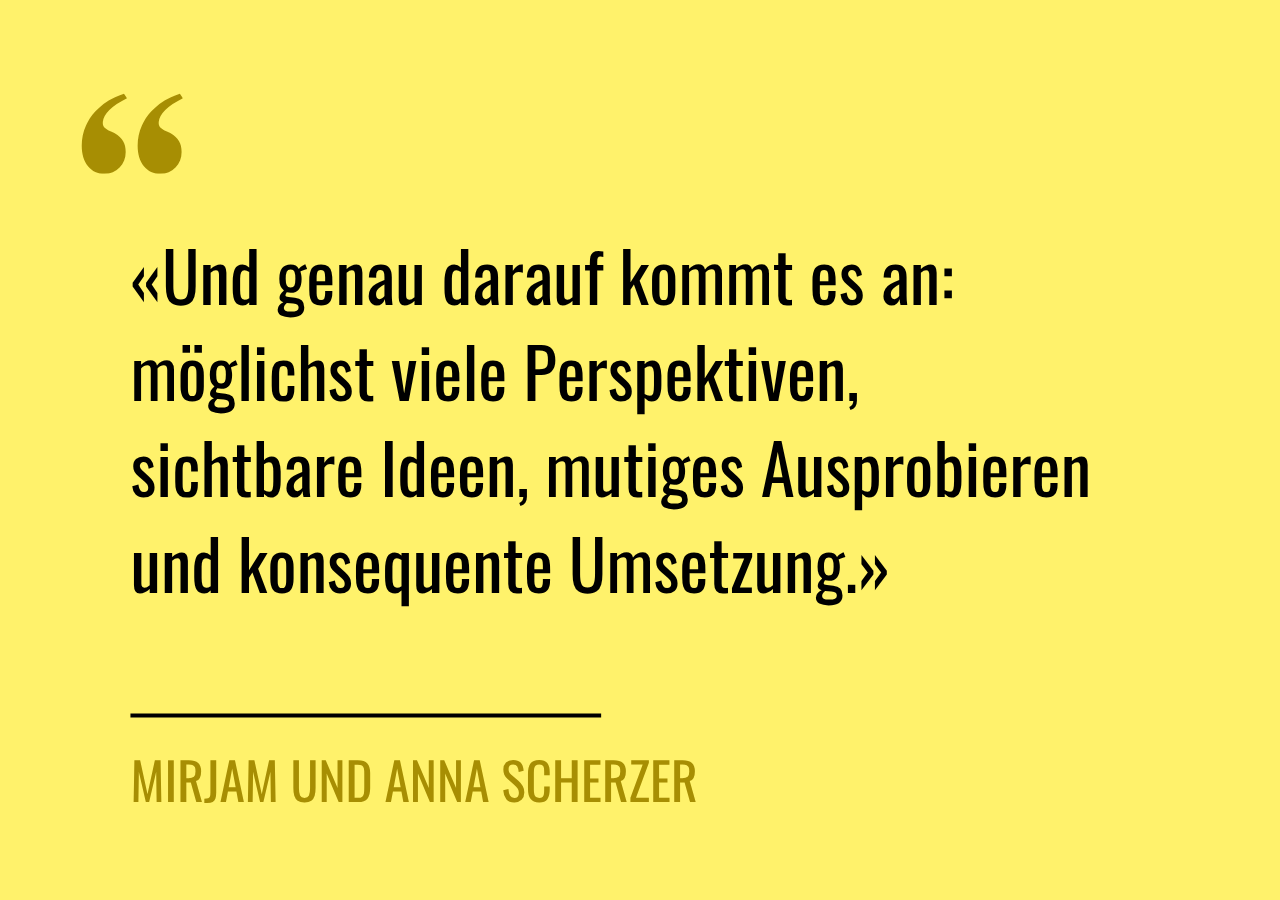
Und genau darauf kommt es an: möglichst viele Perspektiven, sichtbare Ideen, mutiges Ausprobieren und konsequente Umsetzung. Führungskräfte in innovativen Organisationen sind dafür laut Arbeitsmarktstudie im kontinuierlichen Austausch mit ihren Mitarbeitenden: Sie geben Lob und Anerkennung für gute Leistung und nützliches Feedback, dort wo es um Verbesserungen geht, sind aber auch offen für Hinweise und konstruktive Kritik von Seiten der Mitarbeitenden. Sie schaffen ein Klima, das Zusammenarbeit fördert, unterstützen, wo Bedarf besteht, und leben vor, was sie von den Teammitgliedern erwarten.
Kommunikation als Schlüssel
Innovation gelingt nur, wenn die Kommunikation stimmt. Die Avenir-Studie zeigt: In innovativen Organisationen werden Entscheidungen rasch und kontextbezogen kommuniziert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten die Informationen, die sie wirklich brauchen – und verstehen so besser, worauf es strategisch ankommt. Gerade in komplexen Strukturen braucht es ein gemeinsames Verständnis darüber, wer was entscheidet, wer welche Rolle hat, was wichtig ist und was erwartet wird. Diese gemeinsame Ausrichtung entsteht nicht zufällig, sondern durch gezielte, verlässliche Kommunikation. Es geht nicht um ständige Updates, sondern um relevante Orientierung.
Mitarbeitende aktiv einbinden mit Rückenwind der Chefs
Die wirksamsten Innovationsprogramme setzen auf Bottom-up: Mitarbeitende bringen Ideen ein, übernehmen Verantwortung und handeln unternehmerisch. Das stärkt nicht nur die Innovationskultur, sondern auch das Mindset im Unternehmen. Doch diese Initiativen entfalten nur dann langfristig Wirkung, wenn sie vom Topmanagement mitgetragen werden. Ohne klares Commitment der Führung versanden Ideen, verpufft Engagement, schlimmstenfalls führt es zu Frustration und Braindrain.
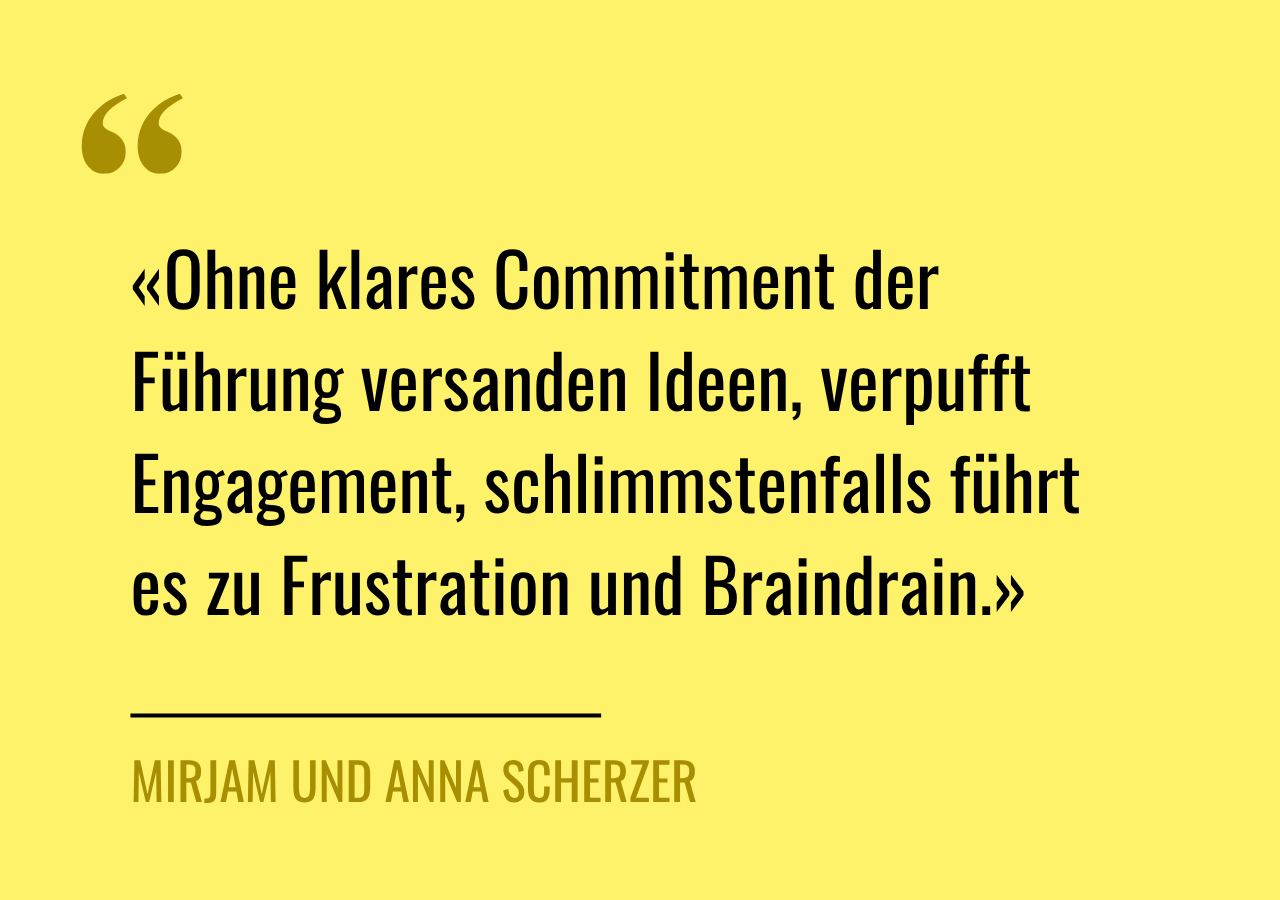
Nur wenn Führung Orientierung gibt und Verantwortung teilt, wird Innovation zur gemeinsamen Aufgabe. Entscheidend ist, ob Partizipation echt ist oder ob Mitarbeitende nur auf Nebenschauplätzen mitreden dürfen. Wer Teams in echte Businessherausforderungen einbindet, stärkt das Vertrauen in die eigene Wirksamkeit und erhöht die Qualität der Lösungen. Auch das bestätigt sich in den Studienergebnissen: In innovativen Organisationen haben Mitarbeitende deutlich mehr Handlungsspielraum in ihren Aufgaben und werden stärker in übergeordnete Entscheidungen eingebunden als bei weniger innovativen Arbeitgebenden.
Kollaboration als strategische Ressource nutzen
Teamwork spielt überall eine wichtige Rolle, unabhängig von der Innovationskraft des Arbeitgebers. Wer sich im Team nicht wohlfühlt, kündigt oft, bevor dies in einer Befragung sichtbar wird. Deshalb werden Teamaspekte in fast allen Organisationen gut bewertet, denn die Unzufriedenen sind oft schon weg.
Spannend ist in der aktuellen Studie jedoch: Wie auch bei den vorangegangenen Themen ist trotzdem ein massiver Unterschied zwischen Bewertungen von Mitarbeitenden in innovativen und weniger innovativen Organisationen feststellbar. Innovation findet dort vermehrt statt, wo alle offen die eigene Meinung äussern können, der Austausch über Teamgrenzen hinweg funktioniert, im Team eine gute Stimmung herrscht und alle für ihre eigenen Fähigkeiten wertgeschätzt werden.
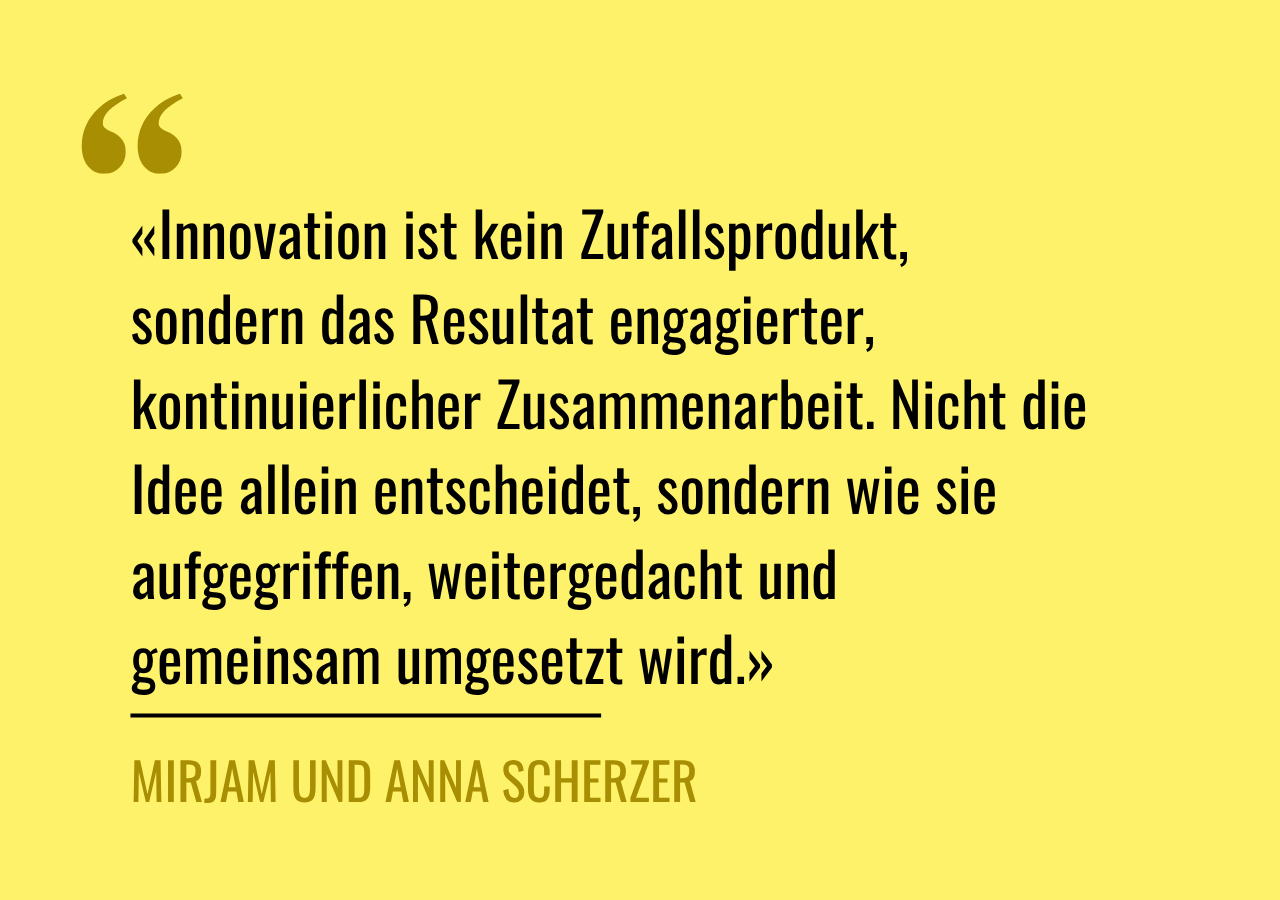
Innovation ist also kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat engagierter, kontinuierlicher Zusammenarbeit. Nicht die Idee allein entscheidet, sondern wie sie aufgegriffen, weitergedacht und gemeinsam umgesetzt wird. Organisationen, die Zusammenarbeit gezielt gestalten, sind resilienter, schneller und lernfähiger. Sie schaffen die Voraussetzung dafür, dass Menschen Verantwortung übernehmen, mitdenken und Neues wagen. Zusammenarbeit ist deshalb mehr als ein Soft Skill, sie ist ein Human Skill.
Neue Spielregeln durch KI
Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz (KI) verändert nun aber scheinbar die Spielregeln, auch in der Zusammenarbeit. Erste Studien, etwa von Harvard, zeigen: Einzelpersonen, die mit KI arbeiten, erzielen in bestimmten Aufgaben bereits bessere Resultate als ganze Teams ohne KI. Das wirft Fragen auf. Ist Zusammenarbeit also ein Auslaufmodell? KI ist kein Ersatz für das Miteinander, sondern eine Ergänzung. Die entscheidende Frage lautet auch künftig nicht: Was kann jede und jeder Einzelne? Sondern: Was bringt das Team weiter als Einzelne allein, auch mit KI?
Fazit: Vielleicht braucht Innovation keinen Event, sondern Alltag
Nicht der grosse neue Innovationsevent führt zum Erfolg, sondern die Art, wie wir täglich zusammenarbeiten. Innovation entsteht nicht im luftleeren Raum. Sie ist Ausdruck einer Kultur, in der Menschen gemeinsam denken, gestalten und Verantwortung übernehmen. Ideen können nur dann ihr Potenzial voll entfalten, wenn dies durch eine motivierende Kultur der Zusammenarbeit unterstützt wird.
Zur Studie
Avenir befragt in regelmässigen Abständen Schweizer Arbeitnehmende, um Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu verfolgen und Arbeitgebende dabei zu unterstützen, sich diesen zu stellen und sie optimal zu nutzen. Dafür wurde zuletzt im Februar 2025 eine repräsentative Stichprobe (nach Geschlecht, Alter und Region) von über 1000 Arbeitnehmenden zur Wahrnehmung ihrer Arbeitssituation befragt.


