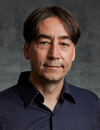Altersdiversität und Unternehmenskultur breit thematisiert
Wie können Unternehmen von Altersvielfalt profitieren – und gleichzeitig die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden stärken? Diese Frage stand im Zentrum der BGM-Tagung 2025 von Gesundheitsförderung Schweiz im Kursaal Bern.

Fotos: Daniel Thüler
Mit rund 920 Teilnehmenden war die diesjährige nationale Tagung für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz am 26. August 2025 im Kursaal Bern einmal mehr sehr gut besucht. Unter dem Titel «Altersdiversität & Unternehmenskultur: Vielfalt als Schlüssel zum Erfolg» stand die Frage im Zentrum, wie Unternehmen altersgemischte Teams erfolgreich führen und dadurch sowohl die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden wie auch die Unternehmenskultur stärken können.
Angesichts des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels wurde deutlich: Organisationen müssen neue Wege finden, um unterschiedliche Lebensphasen, Bedürfnisse und Kompetenzen produktiv zu verbinden – und so eine Arbeitswelt zu gestalten, in der Mitarbeitende aller Generationen gesund, motiviert und langfristig engagiert bleiben.
Vielfalt ist ein Schlüssel zum Erfolg, aber nicht der alleinige
Moderatorin Bigna Silberschmidt eröffnete die Tagung mit einem Blick in die gut besetzte Arena: «Wenn ich jetzt so ins Publikum schaue, sehe ich ganz unterschiedliche Menschen – Geschlechter, Haar- und Hautfarben, Grössen. Und auch das Alter – das ist heute der grosse Fokus.» Vielfalt, so Silberschmidt, sei Herausforderung und Bereicherung zugleich: «Sie kann einen Schlüssel zum Erfolg sein. Nur, wie gelingt das? Darüber sprechen wir heute.»
 In seiner Begrüssung betonte Raffaele De Rosa, Stiftungsratspräsident von Gesundheitsförderung Schweiz, die strategische Bedeutung des BGM: «Die Gesundheit der Mitarbeitenden muss in allen Dimensionen berücksichtigt werden, einschliesslich der psychischen Gesundheit.» Angesichts des rasanten Wandels in Gesellschaft und Wirtschaft sowie des Fachkräftemangels sei die Integration von Altersvielfalt eine zentrale Aufgabe. «Wer in der Lage sein wird, die Vielfalt der Altersgruppen zu bewältigen, wird einen Wettbewerbsvorteil haben – das Unternehmen wird attraktiver und nachhaltiger.»
In seiner Begrüssung betonte Raffaele De Rosa, Stiftungsratspräsident von Gesundheitsförderung Schweiz, die strategische Bedeutung des BGM: «Die Gesundheit der Mitarbeitenden muss in allen Dimensionen berücksichtigt werden, einschliesslich der psychischen Gesundheit.» Angesichts des rasanten Wandels in Gesellschaft und Wirtschaft sowie des Fachkräftemangels sei die Integration von Altersvielfalt eine zentrale Aufgabe. «Wer in der Lage sein wird, die Vielfalt der Altersgruppen zu bewältigen, wird einen Wettbewerbsvorteil haben – das Unternehmen wird attraktiver und nachhaltiger.»
 Eric Bürki, Leiter Betriebliches Gesundheitsmanagement bei Gesundheitsförderung Schweiz, nahm den Tagungstitel kritisch unter die Lupe: «Vielfalt allein ist nicht der Schlüssel zum Erfolg.» Er illustrierte dies mit einem Bild aus dem botanischen Garten: Auch dort gedeihe Vielfalt nur dank Pflege. «Die zentrale Frage ist deshalb: Welche Art von Unternehmenskultur braucht es, damit Altersdiversität funktioniert?»
Eric Bürki, Leiter Betriebliches Gesundheitsmanagement bei Gesundheitsförderung Schweiz, nahm den Tagungstitel kritisch unter die Lupe: «Vielfalt allein ist nicht der Schlüssel zum Erfolg.» Er illustrierte dies mit einem Bild aus dem botanischen Garten: Auch dort gedeihe Vielfalt nur dank Pflege. «Die zentrale Frage ist deshalb: Welche Art von Unternehmenskultur braucht es, damit Altersdiversität funktioniert?»
Aus einer grossen Befragung mit über 80'000 Datensätzen zog er eine klare Schlussfolgerung: «Zu einer guten Unternehmenskultur gehört, dass Beruf und Privatleben vereinbar sind. Das ist höchst gesundheitsrelevant.» Damit gab Bürki die Richtung für die Tagung vor: Vielfalt braucht Strukturen, die getragen und gestaltet werden – durch Führung wie auch durch Mitarbeitende.
Mehr Diversität führt zu mehr Innovation
 Anja Förster, Keynote-Speakerin, Autorin und Gründerin von «Rebels at Work» eröffnete die erste Keynote des Tages, «Anstiftung zum Andersdenken», mit einer Einladung zum gedanklichen «Hubschrauberflug» und nahm das Publikum mit auf eine Reise durch die grossen Umbrüche unserer Zeit. Sie sprach von einer «brutalen Veränderungsgeschwindigkeit», die Unternehmen und Führungskräfte herausfordere: geopolitische Krisen, die Pensionierung der Babyboomer, ein Arbeitsmarkt im Umbruch sowie die Transformation durch Künstliche Intelligenz. «Betriebe sind nicht für Veränderung gebaut, sondern für das effiziente Abarbeiten des Tagesgeschäfts», so Förster. Genau darin liege die Gefahr, da viele Organisationen erst im Angesicht der Krise zu wirklichen Veränderungen bereit seien.
Anja Förster, Keynote-Speakerin, Autorin und Gründerin von «Rebels at Work» eröffnete die erste Keynote des Tages, «Anstiftung zum Andersdenken», mit einer Einladung zum gedanklichen «Hubschrauberflug» und nahm das Publikum mit auf eine Reise durch die grossen Umbrüche unserer Zeit. Sie sprach von einer «brutalen Veränderungsgeschwindigkeit», die Unternehmen und Führungskräfte herausfordere: geopolitische Krisen, die Pensionierung der Babyboomer, ein Arbeitsmarkt im Umbruch sowie die Transformation durch Künstliche Intelligenz. «Betriebe sind nicht für Veränderung gebaut, sondern für das effiziente Abarbeiten des Tagesgeschäfts», so Förster. Genau darin liege die Gefahr, da viele Organisationen erst im Angesicht der Krise zu wirklichen Veränderungen bereit seien.
Besonders eindrücklich zeigte sie auf, dass die Erwartungen an Arbeit sich stark gewandelt haben – vor allem bei jüngeren Generationen. Klassische Aufstiegsperspektiven wie «Visitenkarte mit Titel und ein Eckbüro» seien kaum noch attraktiv. Empirisch belegt sei zudem ein alarmierender Befund: «Nur 15 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz sind hoch engagiert – weitere 15 Prozent haben innerlich bereits gekündigt.» Die grosse Mehrheit erfülle zwar zuverlässig ihre Aufgaben, halte aber Kreativität und Leidenschaft für die Freizeit zurück.
Vor diesem Hintergrund stellte Förster die entscheidende Leitfrage: «Lerne ich eigentlich so schnell wie die Welt sich draussen verändert?» Unternehmen müssten lernen, mit Unsicherheit umzugehen. Zwei Wege seien erkennbar: Entweder versuchten Firmen mit alten Planungsmechanismen Kontrolle zu behalten – «das ist der Weg der minimalen Agilität» – oder sie setzten auf ein klares Zielbild und passten sich iterativ an. «Das ist der Weg der maximalen Agilität – und er ist der einzig richtige.»
Damit leitete Förster zum Kernthema über: Vielfalt als Innovationsmotor. Unterschiedliche Perspektiven seien kein «nice to have», sondern eine Grundbedingung für kreative Lösungen. «Homogenität ist der grösste Killer von Innovation.» Sie illustrierte dies mit einem Beispiel aus einem Unternehmen, das eine 61-jährige Bewerberin trotz Qualifikation vorschnell aussortierte. Solche Reflexe seien Ausdruck einer «homosozialen Reproduktion», die Vielfalt verhindere. Förster nannte dies pointiert «Inzucht in der Unternehmenskultur».
Vielfalt, betonte sie, müsse auch Reibung aushalten: «Du brauchst Widersprüche. Menschen, die sagen: Ich bin nicht einverstanden – und die fundierte Gegenargumente bringen.» Sie verwies auf Unternehmen wie Bridgewater, wo eine «Pflicht zum Widerspruch» gilt. Konstruktive Kritik sei nicht ein Verrat am Teamgeist, sondern ein Schlüssel zu besseren Entscheidungen. «Die erfolgreichsten Führungspersonen sind diejenigen, die die am wenigsten fügsamen Mitarbeitenden fördern.»
Am Ende plädierte Förster leidenschaftlich für ein Umdenken in der Führungskultur: Diversität müsse als bewusstes Prinzip gelebt und durch Strukturen unterstützt werden. Nur so könne es gelingen, die kollektive Intelligenz eines Unternehmens zu entfalten und in einer hochvolatilen Welt zukunftsfähig zu bleiben. Ihr Appell: «Ladet Menschen nicht nur ein, ihre Perspektiven einzubringen – verpflichtet sie dazu. Dann wird Vielfalt zu einem extrem potenten Mittel, um neue Antworten zu finden.»
Unterschiedliche Stärken nutzen
 Prof. Dr. François Höpflinger, Alters- und Generationenforscher sowie Stiftungsrat bei Loopings, dem Kompetenzzentrum für Arbeit 45+, stieg mit einem klaren Befund in die zweite Keynote «Psychische Arbeitsbefindlichkeit – Altersdiversität nutzen» ein: Der Anteil der Erwerbstätigen, die hohen Arbeitsstress erleben, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen – besonders bei jungen Menschen und insbesondere bei jungen Frauen. «Rund ein Viertel der Beschäftigten empfindet mehr Belastung als Entlastung im Arbeitsleben», so Höpflinger. Damit werde Stressbewältigung zu einer entscheidenden Ressource. Hier könnten ältere Mitarbeitende wertvolle Beiträge leisten, da sie über mehr Erfahrung im Umgang mit schwierigen Situationen verfügen.
Prof. Dr. François Höpflinger, Alters- und Generationenforscher sowie Stiftungsrat bei Loopings, dem Kompetenzzentrum für Arbeit 45+, stieg mit einem klaren Befund in die zweite Keynote «Psychische Arbeitsbefindlichkeit – Altersdiversität nutzen» ein: Der Anteil der Erwerbstätigen, die hohen Arbeitsstress erleben, ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen – besonders bei jungen Menschen und insbesondere bei jungen Frauen. «Rund ein Viertel der Beschäftigten empfindet mehr Belastung als Entlastung im Arbeitsleben», so Höpflinger. Damit werde Stressbewältigung zu einer entscheidenden Ressource. Hier könnten ältere Mitarbeitende wertvolle Beiträge leisten, da sie über mehr Erfahrung im Umgang mit schwierigen Situationen verfügen.
Altersdiversität biete die Chance, unterschiedliche Stärken zu verbinden. Höpflinger betonte, dass Generationen unterschiedliche Perspektiven haben, da sie in verschiedenen historischen Kontexten sozialisiert wurden – die «Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen». Dennoch seien die Wertunterschiede zwischen Jung und Alt in der Schweiz vergleichsweise moderat. Auffällig sei jedoch, dass sich jüngere Beschäftigte häufiger mit ihren persönlichen Werten im Konflikt sehen und deshalb weniger stark mit ihrer Arbeit identifizieren.
Gleichzeitig warnte er davor, Generationenunterschiede zu überzeichnen. «Generationen-Diskurse sind oft überlagert von gesellschaftlichen Zukunftsängsten», erinnerte er. Schon früher habe man sich über die vermeintliche Faulheit der Jugend beklagt. Wichtiger als Alterseffekte seien oft andere Faktoren wie Stadt-Land-Unterschiede oder soziale Herkunft. Zudem veränderten sich Einstellungen im Laufe des Lebens: «Wir haben nicht nur Jugendliche, sondern auch jugendliche Erwachsene – und manchmal sogar jugendliche Pensionierte.»
Für Unternehmen sei entscheidend, nicht nur Diversität zu haben, sondern ein positives Diversitätsklima zu schaffen. Ohne aktives Management könne Vielfalt kontraproduktiv wirken – etwa, wenn ältere Führungskräfte krampfhaft versuchen, «jung» zu wirken, oder wenn das Wissen junger Mitarbeitender nicht ernst genommen wird. Besonders im Gesundheitswesen zeige sich, dass die Erfahrung älterer Mitarbeitender bei kritischen Situationen für Jüngere enorm entlastend wirken könne. Mentoring sei dabei sinnvoll – allerdings nur, wenn es freiwillig geschehe.
Höpflinger illustrierte, dass Diversität auch im Kundenkontakt relevant ist. So könne es wichtig sein, ältere Kundinnen und Kunden durch gleichaltrige Berater betreuen zu lassen – während Jüngere andere Bedürfnisse hätten. Entscheidend sei, dass Führung ein Klima schaffe, in dem unterschiedliche Perspektiven als Ressource gelten. «Diversität an sich kann auch negative Folgen haben – entscheidend ist, wie sie gestaltet wird.»
Besondere Bedeutung für die psychische Gesundheit habe der generationenübergreifende Austausch in drei Situationen: beim Berufseinstieg, bei existenziellen Herausforderungen wie Krankheit oder Tod sowie in der Teamzusammenarbeit. Hier könnten ältere Mitarbeitende durch ihre Erfahrung Orientierung bieten, während Jüngere neue Impulse einbrächten. Erfolgreich sei dieser Austausch jedoch nur, wenn er von gegenseitigem Respekt geprägt sei und auf Freiwilligkeit basiere.
Abschliessend plädierte Höpflinger dafür, Altersdiversität als Chance für Resilienz und Innovationsfähigkeit zu begreifen. Erfahrung und Neugier, Stabilität und Dynamik müssten in Balance gebracht werden. «Entscheidend ist nicht die Vielfalt selbst, sondern die Qualität des Umgangs damit – das Diversitätsklima.»
Interessante Subplenen und Workshops
 Nach den beiden Keynotes wurden zahlreiche Subplenen und Workshops geboten, beispielsweise von Barbara Studer und Christian Schmid von der Hirncoach AG zum Thema «Chancen von altersdurchmischten Teams – neurowissenschaftliche und unternehmerische Perspektive». Eine ihrer Kernaussagen war, dass Spannung zwischen unterschiedlichen Generationen ein fruchtbarer Nährboden für Innovation ist. «Spannung ist Stretching für unser Gehirn – mental, sozial und geistig», erklärte Studer. Altersdiverse Teams wirkten sich nicht nur positiv auf die Zusammenarbeit, sondern auch auf die Hirngesundheit und geistige Agilität aus.
Nach den beiden Keynotes wurden zahlreiche Subplenen und Workshops geboten, beispielsweise von Barbara Studer und Christian Schmid von der Hirncoach AG zum Thema «Chancen von altersdurchmischten Teams – neurowissenschaftliche und unternehmerische Perspektive». Eine ihrer Kernaussagen war, dass Spannung zwischen unterschiedlichen Generationen ein fruchtbarer Nährboden für Innovation ist. «Spannung ist Stretching für unser Gehirn – mental, sozial und geistig», erklärte Studer. Altersdiverse Teams wirkten sich nicht nur positiv auf die Zusammenarbeit, sondern auch auf die Hirngesundheit und geistige Agilität aus.
Schmid erinnerte daran, dass Altern alle betrifft und nicht nur Einschränkungen, sondern auch Ressourcen mit sich bringt: «Mit den Jahren wächst unser Erfahrungsschatz, unsere Gelassenheit und unser Netzwerk.» Diese Stärken seien in einer komplexen und schnelllebigen Wirtschaft von grossem Wert. Da heute bereits 56 Prozent der Erwerbstätigen in der Schweiz über 40 Jahre alt sind, werde Altersdiversität künftig noch wichtiger.
Die Referierenden zeigten auf, dass altersgemischte Teams Innovation fördern, wenn sie von psychologischer Sicherheit und gegenseitiger Wertschätzung getragen werden. Studien belegten, dass Unternehmen mit altersdiversen Teams bis zu 19 Prozent höhere Umsätze erzielen. Voraussetzung sei aber, dass Stärken und Schwächen anerkannt und offen kommuniziert würden. «Ohne Wertschätzung entsteht schnell ein Gegeneinander», warnte Schmid.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Aufbrechen von Altersstereotypen. Studer verwies auf die Neuroplastizität des Gehirns: «Man kann in jedem Alter Neues lernen – das Gehirn liebt Herausforderungen.» Entscheidend sei, ältere Mitarbeitende nicht zu früh abzuschreiben und Jüngeren zugleich Raum für ihre Impulse zu geben. Führungskräfte hätten dabei die Aufgabe, günstige Rahmenbedingungen zu schaffen.
Abschliessend plädierten beide für mehr Humor und Leichtigkeit im Umgang miteinander: «Wenn wir nicht viel miteinander lachen könnten, hätten wir schon längst aufgehört.» Humor, so Studer, sei nicht nur gesund, sondern auch förderlich für Innovation und Produktivität.
Verleihung der «Friendly Work Space»-Label und Networking
Als Novum der diesjährigen BGM-Tagung wurden am Nachmittag von Gesundheitsförderung Schweiz – parallel zum regulären Programm – die «Friendly Work Space»-Labels verliehen. 8 Organisationen wurden zum ersten Mal mit dem Label «Friendly Work Space» ausgezeichnet, 25 Organisationen haben sich nach 3 Jahren erfolgreich einem Re-Assessment gestellt. Sie alle engagieren sich nachweislich für ein systematisches BGM und fördern aktiv die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Zurzeit sind 111 Firmen und Organisationen mit rund 220'000 Mitarbeitenden mit dem Label «Friendly Work Space» ausgezeichnet.
 Für Auflockerung zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte das Duo «anundpfirsich», das mit witzigem Improtheater für zahlreiche Lacher im amüsierten Publikum sorgte.
Für Auflockerung zwischen den einzelnen Programmpunkten sorgte das Duo «anundpfirsich», das mit witzigem Improtheater für zahlreiche Lacher im amüsierten Publikum sorgte.
Mehrere Kaffeepausen, eine längere Mittagspause mit Verpflegung vom Buffet und ein Apéro zum Abschluss boten zudem den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen – eine Chance, die rege genutzt wurde.