Die Weichen richtig stellen
Ein Bündel von verschiedenen guten Wettbewerbsfaktoren und Standortvorteilen zeichnet die Schweiz aus. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss sie jedoch weiterhin Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren und Absatzmärkte ausserhalb des Euroraumes bearbeiten.

Die Schweiz muss heute die Weichen für die Zukunft stellen. (Foto: iStockphoto)
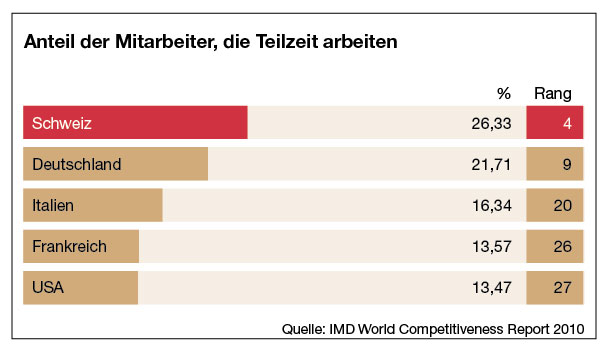
Die Schweiz ist arm an Rohstoffen, aber reich an klugen Köpfen und findigen Ideen. Zur attraktiven Wettbewerbsposition der Schweiz tragen auch Standortvorteile wie ein hoher Wissensstand, ein gutes Berufs- und Bildungssystem, eine politische und wirtschaftspolitische Stabilität, tiefe Steuern, der gute Ruf als Technologiestandort und der starke Finanzplatz bei. Weitere wichtige attraktive Standortvorteile sind für Patrick Djizmedjian, Sprecher der Osec, der Schweizer Aussenwirtschaftsförderin, auch die ausgezeichnete Infrastruktur, gute Mobilität und Logistik sowie die zentrale Lage innerhalb Europas. Die Osec unterstützt seit 1927 schweizerische Unternehmen bei ihren internationalen Geschäftsvorhaben und kümmert sich seit 2008 im Auftrag des Bundes auch um die nationale Standortpromotion der Schweiz im Ausland und die Importförderung.
Beachtet und beneidet: das Bildungssystem der Schweiz
Kluge Köpfe wollen gefordert, ausgebildet und gefördert werden. In der Schweiz finden sie dank dem guten Berufs- und Bildungssystem und den international anerkannten Hochschulen gute Bedingungen dafür. «Das Know-how ist etwas vom Fundamentalsten, über das wir in der Schweiz verfügen und das wir auch in Zukunft weiterhin in der Wirtschaft zur Anwendung bringen müssen», sagt Patrick Djizmedjian. Im Ausland werde das berufliche Bildungssystem der Schweiz beachtet oder sogar beneidet: «In den USA etwa interessiert man sich, wie das berufliche Bildungssystem mit dem Lehrlingswesen bei uns funktioniert.»
Das duale Bildungssystem, das Akademikern wie Praktikern eine gute Ausbildung gewährleistet, ist auch für Rudolf Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse, von entscheidender Bedeutung: «Verglichen mit dem Ausland sind die Ausbildungsgänge in der Schweiz wettbewerbsfähig.» Besser als im Ausland seien die Bildungsgänge in der Schweiz hingegen oft nicht. «Der Zustrom an die Universitäten und die Fachhochschulen in den letzten Jahren ist nicht immer nur mit einer Qualitätshaltung einhergegangen», gibt Minsch zu bedenken. Zudem ist das schweizerische System nur so lange erfolgreich, wie man weiss, welchen Wert die Ausbildungslehrgänge der Fachhochschulen und Höheren Fachschulen haben. Rudolf Minsch: «Absolventen der Höheren Fachschulen können, was das Level betrifft, häufig mit den Hochschulabsolventen mitschwimmen. Trotzdem ziehen immer mehr Unternehmen tendenziell Akademiker vor, was auch damit zu tun hat, dass HR-Positionen oft nicht mehr mit Schweizern besetzt sind.»
Ein entspanntes Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern
Rudolf Minsch sieht zudem ein grosses Potenzial bei den Universitätsabsolventen auf der Stufe Bachelor: «Aus berufsfremden Studienrichtungen wie etwa Geisteswissenschaften sollten HR-Leute die Absolventen möglichst früh in die Unternehmen holen, statt zu warten, bis sie den Master gemacht haben.» Dies sei sinnvoll, weil Universitätsabsolventen Zeit brauchen, um Erfahrungen in der Praxis zu sammeln. Wenn man Bachelorabsolventen intern für bestimmte Dienstleistungs-, Management- und Zulieferfunktionen ausbilde, gebe man ihnen eine Chance und nutze darüber hinaus das Potenzial, die Leute relativ kostengünstig einzusetzen.
In einem Punkt unterscheidet sich die Schweiz stark von anderen Ländern: Hierzulande befinden sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber in einem relativ entspannten Verhältnis zueinander. Es wird wenig gestreikt, und das schweizerische Stimmvolk hat soeben die Ferieninitiative abgelehnt. Thomas Daum, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, sieht den Grund dafür im pragmatischen Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmenden: «Die Erwerbschancen, die Arbeitsplatzsicherheit, die Löhne und die Karrierechancen sind deutlich höher als im Ausland. Die soziale Sicherheit ist insgesamt ebenfalls besser als in den meisten OECD-Staaten.» Für die Zukunft wünscht sich Thomas Daum, dass die Erfolgsfaktoren der schweizerischen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung weiterhin gepflegt und vor allem in internationalen Unternehmen gegen die Uniformierung in globalen Management-Standards verteidigt werden. Thomas Daum: «Der Gebrauch von mehr ‹Common Sense› würde zum Beispiel vielen HR-Verantwortlichen helfen, die demografische Entwicklung endlich als unternehmensstrategische Herausforderung erster Priorität zu erkennen.»
Firmen an der Peripherie profitieren von den Zentren
Eine weitere Besonderheit der Schweiz ist es, dass es den Unternehmen gelingt, auch in den Regionen erfolgreich zu sein. Gründe dafür gibt es gemäss Marie Avet, stellvertretende Kommunikationsleiterin des Staatssekretariates für Wirtschaft SECO, gleich mehrere: «Die grösseren Ballungszentren in der Schweiz sind auf das ganze Land verteilt. Das Verkehrs- und Telekommunikationssystem ist gut ausgebaut, und die Nachbarregionen im Ausland gehören zu den wettbewerbsfähigen Standorten Europas.» Deshalb hätten Unternehmen in den sogenannt peripheren Gebieten einen vergleichsweise guten und raschen Zugang zu den Wachstums- und Wettbewerbsvorteilen der Metropolen und Agglomerationen.
Auch Marie Avet betont, dass der wirtschaftliche Erfolg und die Konkurrenzfähigkeit der Schweiz entscheidend von Bildung, Forschung und Innovation abhängen. Deshalb werde die Schweiz auch in Zukunft in Humankapital investieren. «Dabei ist es von grosser Bedeutung, dass sich die ansässige Bevölkerung in einem hohen Ausmass am Arbeitsmarkt beteiligt», so Marie Avet. Damit dies gelinge, müsse man unter anderem die Vereinbarkeit von Beruf und Familie weiter verbessern und die hohe Beschäftigungsrate älterer Arbeitnehmer bewahren. Hier seien die Unternehmen und deren HR-Bereiche allgemein und im Besonderen die Linienverantwortlichen gefordert.
Die gute Mischung von KMU und Grossunternehmen ist für den Werkplatz Schweiz ebenfalls vorteilhaft. «Im Vergleich zum Beispiel Österreich hat die Schweiz den wichtigen Vorteil, dass hier zahlreiche multinationale Unternehmen wie Nestlé, Schindler oder Novartis ansässig sind. Diese haben in Krisenzeiten einen längeren Atem, verfügen über mehr Ressourcen für Forschung und Entwicklung und sind international gut vernetzt», erklärt Rudolf Minsch. Von diesen Pluspunkten profitierten auch KMU, wenn sie im Windschatten dieser Grossunternehmen die internationalen Märkte erobern. Beispielsweise als Zulieferer in der Schweiz, die diese Funktion auch international übernehmen und sich so stärker globalisieren können.
Globalisieren ist nicht nur ein Schlagwort, sondern könnte für manches schweizerische Unternehmen in naher Zukunft eine wirtschaftliche Notwendigkeit darstellen. Rudolf Minsch: «Der zentrale Problempunkt sind im Augenblick die schwierige Kostensituation durch den starken Franken, die Unsicherheit in Europa und die Eurokrise.» Deutschland sei mit rund 20 Prozent des schweizerischen Exportvolumens der wichtigste Handelspartner, und weitere 15 Prozent des Exports gehen an Frankreich und Italien. Daraus resultiere der Zwang, die Nachfrageschwäche durch neue Märkte in Asien, beispielsweise China, zu ersetzen. «Die grosse Frage ist, ob die Schweizer Industrie in dieser Globalisierungsdynamik mithalten kann. Bisher tat sie das sehr erfolgreich», so Rudolf Minsch.
Die kaufkräftige Mittelschicht von Brasilien bis Indonesien
Auch Patrick Djizmedjian von der Osec erachtet es für schweizerische Unternehmen als wichtig, potenzielle Käufer von neuen, aufstrebenden Ländern wie Indien und Indonesien, Brasilien und China im Auge zu behalten: «In diesen Ländern entwickelt sich zunehmend eine kaufkräftige Mittelschicht. Millionen von Menschen sind dort auch bereit, für qualitativ hochstehende Schweizer Produkte, die sich unter anderem durch Präzision, Langlebigkeit und Innovation auszeichnen, einen höheren Preis zu bezahlen.» Deshalb rät die Osec ihren Mitgliedern und Kunden – häufig KMU –, mittel- bis langfristig die Exportstrategie so zu gestalten, dass sie auch Märkte ausserhalb des Euroraums bearbeiten. Dies nicht zuletzt, um auch die negativen Folgen des aktuell starken Schweizer Frankens etwas abzufangen.
Dass so viele Schweizer Unternehmen erfolgreich im Ausland vertreten sind, hat gemäss Patrick Djizmedjian auch damit zu tun, dass sie als sehr innovativ gelten. Für Rudolf Minsch ist Innovation nicht ein Nice-to-have, sondern ein Muss, um international mit dem starken Franken wettbewerbsfähig zu sein: «Eine unserer Umfragen hat kürzlich ergeben, dass man in einem Hochlohnland wie der Schweiz nach Kostensenkungen und Produktivitätserhöhungen nun verstärkt auf die Innovation setzen muss, um mehr Wertschöpfung zu generieren.»
Die Innovationsfähigkeit geht Hand in Hand mit guten Mitarbeitenden – und diese werden die Unternehmen in Zukunft immer häufiger im Ausland rekrutieren müssen. «Ohne Zuwanderung hätte die Wissensnation Schweiz einfach zu wenig Leute», so Rudolf Minsch. Die Forderung von Economiesuisse an die Politik ist daher, die Personenfreizügigkeit unbedingt weiter zu erhalten und nicht durch das kommende Referendum zu gefährden. «Es besteht die ganz grosse Gefahr, dass wir durch falsche politische Weichenstellungen den Wettbewerbsstandort Schweiz mittelfristig gefährden.» Dazu könnten gemäss Minsch auch Massnahmen wie die Bankenregulierung beitragen – zumal die Wertschöpfung der Bankindustrie direkt oder indirekt rund 18 Prozent beträgt.
Gegen den «Expat-Blues» sind mehrere Kräuter gewachsen
Es ist auch wichtig, dass sich ausländische Mitarbeitende in unserem Land wohlfühlen. Hierzu stellt Patrick Djizmedjian fest, dass in der Schweiz im Vergleich zu Arbeitnehmenden aus dem angelsächsischen Raum für Fachkräfte aus China, Indien, Korea oder Brasilien, deren Herkunftsländer in der Weltwirtschaft immer wichtiger werden, noch kaum Netzwerke oder Communities existieren, die das Wohlbefinden dieser Arbeitskräfte und ihrer Familienangehörigen fördern. Nicht zuletzt lohnt es sich, auch die vormals berufstätigen Ehefrauen von hochqualifizierten Expats im Auge zu behalten und ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Denn alle Vorteile der Schweiz als Arbeitsort nützen nichts, wenn ausländische Arbeitskräfte am «Expat-Blues» leiden und dem Wirtschaftsstandort Schweiz aus diesem Grund wieder den Rücken kehren.
Zwischen 2009 und 2010 hat der Bund Massnahmen ergriffen, um die Schweizer Wirtschaft nach der Rezession Ende 2008 zu stabilisieren. Es waren Massnahmen in den folgenden Bereichen: Verfestigung der öffentlichen Nachfrage, Unterstützung der Arbeitslosen, Stärkung der Wachstumschancen der Wirtschaft, Stärkung der Exportwirtschaft, Stützung der Einkommen der Haushalte, Aufschub der Mehrwertsteuererhöhungen und vorgezogene Einführung der Mehrwertsteuerreform. International gesehen, folgerte das SECO, habe die Schweizer Exportindustrie von der robusten Nachfrage aus den Entwicklungs- und Schwellenländern profitiert. www.stabilisierung.ch.
