Führung nach Rezept
Man nehme Aceto (Ziele), Olivenöl (Sinn), Soja (Coaching) und Agavendicksaft (Beziehungen) – kräftig mischen, je nach Lage nachwürzen. Gut verrühren und situativ dosieren. Gemeinsam im Team geklärt servieren.
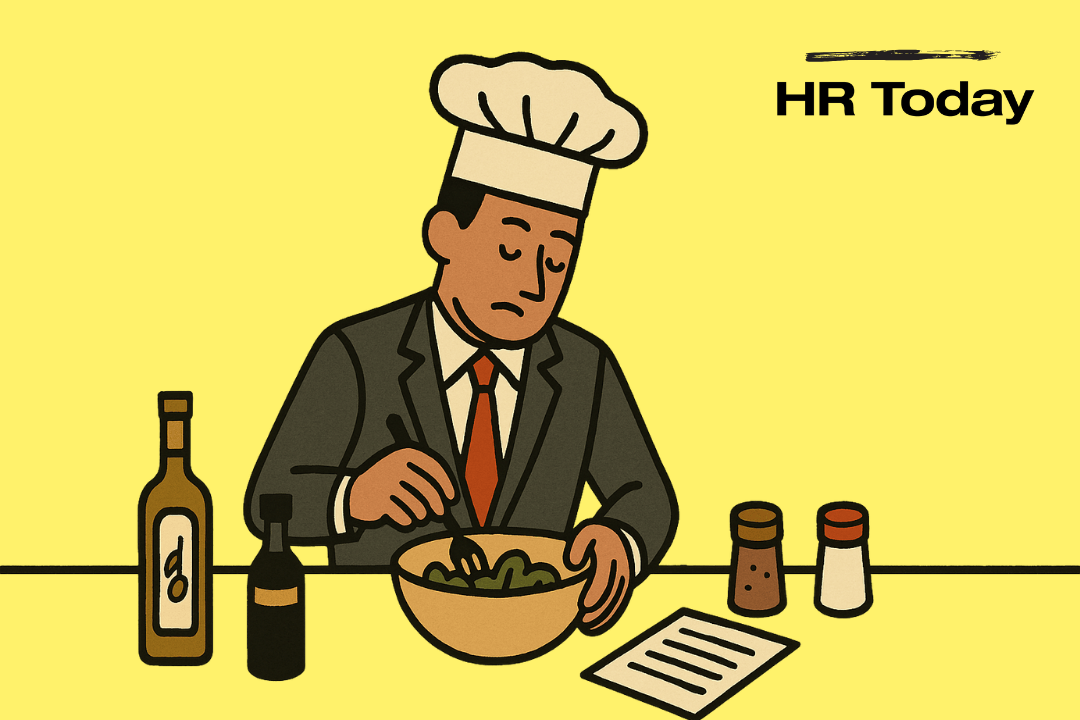
Führen bedeutet Kochen – und dafür braucht es gute Rezepte. (Bild: ChatGPT / Canva)
Seit mehr als einem Jahrhundert wird Führung intensiv erforscht, da die Wirkung auf ein Team, eine Organisation und damit auf ein ganzes Unternehmen nachweislich gross ist.
Zwischenzeitlich argumentieren die neusten Führungsmodelle wie «transaktional-transformationales Führen»¹ oder «PERMA-Lead»², dass Führungsverhalten nicht nur über Mitarbeitendenzufriedenheit entscheidet, sondern gute Führungspersonen und dadurch gut funktionierende Teams einen Profitabilitätsfaktor darstellen. Während solche Wirkungsdiskussionen spannend sind, bleibt die Schlüsselfrage, was Führung ist und welchen Mix eine Führungsperson zu leben hat.
Das Rezept für wirkungsvolle Führung ist so einfach wie die Anleitung für eine Salatsauce und lässt sich aus Wunderers Definition von Führung ableiten. Er argumentiert, dass Führung verstanden wird als ziel- und ergebnisorientierte, aktivierende und wechselseitige, soziale Beeinflussung zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in und mit einer strukturierten Arbeitssituation Was sich kompliziert liest, reduziert sich auf nachstehende Zutaten.
Vier Zutaten oder vier Führungsrollen
Manager
Unternehmen existieren, solange sie ein Marktbedürfnis erfüllen, weshalb es eine Ziel- und Ergebnisorientierung braucht. Als Manager ist eine Führungsperson deshalb dafür verantwortlich, dass ein Team sich an Unternehmenszielen orientiert, eine Strategie auf den eigenen Bereich übersetzt wird und ein Output entsteht. Das Sicherstellen einer solchen Verbindlichkeit und das Monitoring der Ergebniserreichung . mag im Kontext der Ansprüche jüngerer Generationen nicht besonders sexy sein. Und trotzdem bleibt die Management-Aufgabe, vergleichbar mit einem Aceto Balsamico in einer Salatsauce, ein Kernaspekt von Führung.
Leader
Ein aktiver Einbezug bei Entscheidungen (wechselseitige soziale Beeinflussung), ein Aufzeigen der Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns (Aktivierung) ebenso wie das Sicherstellen eines Teamzusammenhalts (Erfüllung gemeinsamer Aufgaben) beschreiben die Rolle eines Leaders. Leader möchten als Individuum gesehen werden, verstehen, was ihr Beitrag zum grossen Ganzen ist und ihren Platz im Team finden. Zwischenzeitlich hat diese Rolle im Vergleich zur Managerrolle an Wichtigkeit gewonnen, so wie es auch mehr Olivenöl als Aceto Balsamico für eine Salatsauce braucht.
Coach
Ein Unternehmen – aber auch ein Markt – (strukturierte Arbeitssituation) verändern sich laufend, weshalb ein Team sich kontinuierlich weiterentwickeln muss. Als Coach ist eine Führungsperson deshalb verantwortlich, dass Mitarbeitende dazulernen, arbeitsmarktfähig bleiben undoffen sind für Veränderungen. Dabei geht es weniger um das Aufsetzen von Weiterbildungsmassnahmen als um die Begleitung im Arbeitsalltag – was oft vergessen geht. Doch wie eine Salatsauce ohne Sojasauce geschmacklos bleibt, braucht es Coaching als Teil der Führung.
Networker & Matchmaker
Der Unternehmenskontext definiert den Handlungsspielraum eines Teams (strukturierte Arbeitssituation), weshalb eine Führungsperson als Networkerin und Matchmakerin für die Schnittstellenpflege verantwortlich ist. Die Interessen des Teams sind nach aussen zu tragen, Mitarbeiternde sind mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu bringen. Eine solche Beziehungspflege lässt sich mit dem Agavendicksaft vergleichen, der die Salatsauce zusammenhält und eine leichte Süsse schafft.
Zubereitung oder Selbstführung und Rollenklärung als Grundlage
Damit der Mix aus Manager, Leader, Coach, Networker und Matchmaker gelingt, braucht es Selbstführung ebenso wie Klarheit, was die eigene Führungsambition ist und welche Erwartungen ein Team an Führung hat.
Während sich Gesicht und Kleidung einer Führungsperson (zumindest während eines Tages) nicht verändern, wechselt der Führungsfokus fortwährend, was zu Missverständnissen und Irritationen führen kann: Ich wünsche mir als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einen Leader und bekomme einen Coach. Ich möchte Coach sein und werde in die Managerinnenrolle geschoben. Rollenerwartungen offenzulegen und aktiv zu verhandeln, ist deshalb ein Erfolgsfaktor bei der Führungszubereitung.
Welcher Mix soll es für Sie sein?
Jedes Rezept ist Ausgangspunkt für die eigene Kreation und nachfolgende Fragen helfen Ihnen bei der Klärung Ihrer eigenen Führungsambition und des resultierenden Führungsverhaltens.
- In welchen Momenten sind Sie Manager? Wann sollten Sie es noch mehr, wann weniger sein?
- Inwieweit gelingt es Ihnen, auf der Sachebene hartnäckig zu sein, während Sie auf der Beziehungsebene zugewandt und empathisch sind?
- Mit welchen Aspekten der Managerrolle haben Sie noch Mühe? Wie können Sie diese noch mehr akzeptieren, um entspannter und mit noch mehr Freude Manager zu sein?
- In welchen Momenten sind Sie Leader? Wann sollten Sie es noch mehr, wann weniger sein?
- Wie erinnern Sie sich selbst immer wieder an das grosse Ganze?
- Wie gelingt Ihnen Bodenhaftung und Verbindung mit dem Operativen, während Sie ebenfalls an die kommenden Herausforderungen denken?
- In welchen Momenten sind Sie Coach? Wann sollten Sie es noch mehr, wann weniger sein?
- Wie schenken Sied em Gegenüber Freiraum zum eigenen Denken und kommunizieren gleichzeitig Ihre eigenen Erwartungen?
- Wie erkennt Ihr Gegenüber, dass Sie in der Coachingrolle sind?
- In welchen Momenten sind Sie Networker und Matchmakerin? Wann sollten Sie es noch mehr, wann weniger sein?
- In welchem Ausmass ist Netzwerken für Sie bereits Teil von Führung?
- Was sind die Erwartungen Ihres Teams an Sie hinsichtlich dieses Vertretens nach aussen?
- Wenn all Ihre Antworten und Erkenntnisse jetzt zusammenfliessen: Was ist Ihr Führungsmix, mit dem Sie und Ihr Umfeld sich wohlfühlen?
Welchen Mix will Ihr Team?
Führung entsteht aus der Zusammenarbeit, weshalb ein Erwartungsabgleich, etwa in Form eines Workshops, beim Zusammenstellen des Rezepthelfen kann. Folgende Schritte helfen Ihnen, den Erwartungsabgleich zu strukturieren.
Check-in: Alle notieren für sich, was Führung für sie ist und teilen danach ihr Verständnis.
Klärung Führungsbegriff und Vorstellen der Führungsrollen: Vorstellen einiger Führungsdefinitionen als Ergänzung zum Check-in und Vorstellen der vier Führungsrollen als Orientierungspunkt für den Erwartungsabgleich.
Abgleich der Führungserwartungen: In Kleingruppen den gewünschten Rollenmix entwickeln lassen (Welche Rolle braucht es in welchem Ausmass? Welche Aufgaben gehören dazu? Welches Führungsverhalten braucht es?) und danach gemeinsam diskutieren.
Fazit und Check-out: Wichtigste Erkenntnisse des Erwartungsabgleichs notieren und alle teilen, was sie aus dem Erwartungsabgleich für sich mitnehmen.
¹Avolio und Bass beschreiben in ihrem Full Range Leadership Modell (1991) transaktionale und transformationale Führung wie folgt: Transaktionale Führung organisiert Zusammenarbeit über Zielvereinbarungen, Feedback und Konsequenzen: Wer Ziele erreicht, erhält Anerkennung oder Anreize; Abweichungen werden erkannt, adressiert und durch Kurskorrekturen behoben. Transformationale Führung hingegen versucht, die Werte und Ziele der Geführten zu verändern, um eine zusätzliche Leistungssteigerung zu erreichen, indem sie auf intrinsische Motivation, gemeinsame Visionen und die Entwicklung der Mitarbeitende abzielt.
²PERMA-Lead (Ebner, 2019) ist ein Führungsstil, der auf der Positiven Psychologie basiert und das Ziel hat, eine positive Arbeitsumgebung zu schaffen, in der Mitarbeitende ihr volles Potenzial entfalten können. Der Begriff PERMA-Lead ist ein Akronym, das für die fünf Schlüsselelemente steht, die für das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit von Mitarbeitende entscheidend sind: Positive Emotionen, Engagement, Beziehungen (Relationship), Sinnhaftigkeit (Meaning) und Erfolg (Accomplishments).



