«Je mehr Drama, desto weniger Sicherheit – und Leistung»
In unsicheren Zeiten wird psychologische Unsicherheit umso mehr zum Erfolgsfaktor. Autor, Dozent und Berater Joachim Maier erklärt, warum Angst lähmt – und wie dramafreie Teams zu lernenden Organisationen beitragen.

Individuelle Defensivreaktionen werden von unserem autonomen Nervensystem ausgelöst. (Bild: ChatGPT / Canva)
HR Today: Wie kann psychologische Sicherheit entstehen in einer Zeit, in der Chaos und Unklarheit den Alltag und die Weltpolitik prägen?
Joachim Maier: Psychologische Sicherheit punktet in dieser unberechenbaren, von fundamentaler Unsicherheit geprägten Welt mit einem wissenschaftlich belegbaren Versprechen: Wer erfolgreich sein will, sollte um psychologische Sicherheit besorgt sein – um zumindest im engsten Kreis seiner Arbeitsgruppe dramafrei und damit erfolgreich zusammenarbeiten zu können. Wer möchte nicht wenigsten in seinem Mikrokosmos zu einem Safespace beitragen, wenn die Welt um einen herum aus den Fugen zu geraten droht? Psychologische Sicherheit beschreibt ein Gruppenklima, in dem Menschen sich angstfrei, offen und aufrichtig einbringen können. Man erkennt und fördert psychologische Sicherheit anhand der Faktoren «gleichberechtigte Redeanteile» und «soziale Sensibilität» – belegt durch Googles Aristoteles-Studie. Ihr Zwilling ist unser inneres Sicherheitsempfinden, das unser autonomes Nervensystem permanent rückmeldet und bei Verletzungen unwillkürlich individuelle Defensivreaktionen auslöst. Innere und psychologische Sicherheit sind, wie mein Buch aufzeigt, über eine Stärkung der psychologisch sicheren Kreise im Team zuverlässig moderierbar.
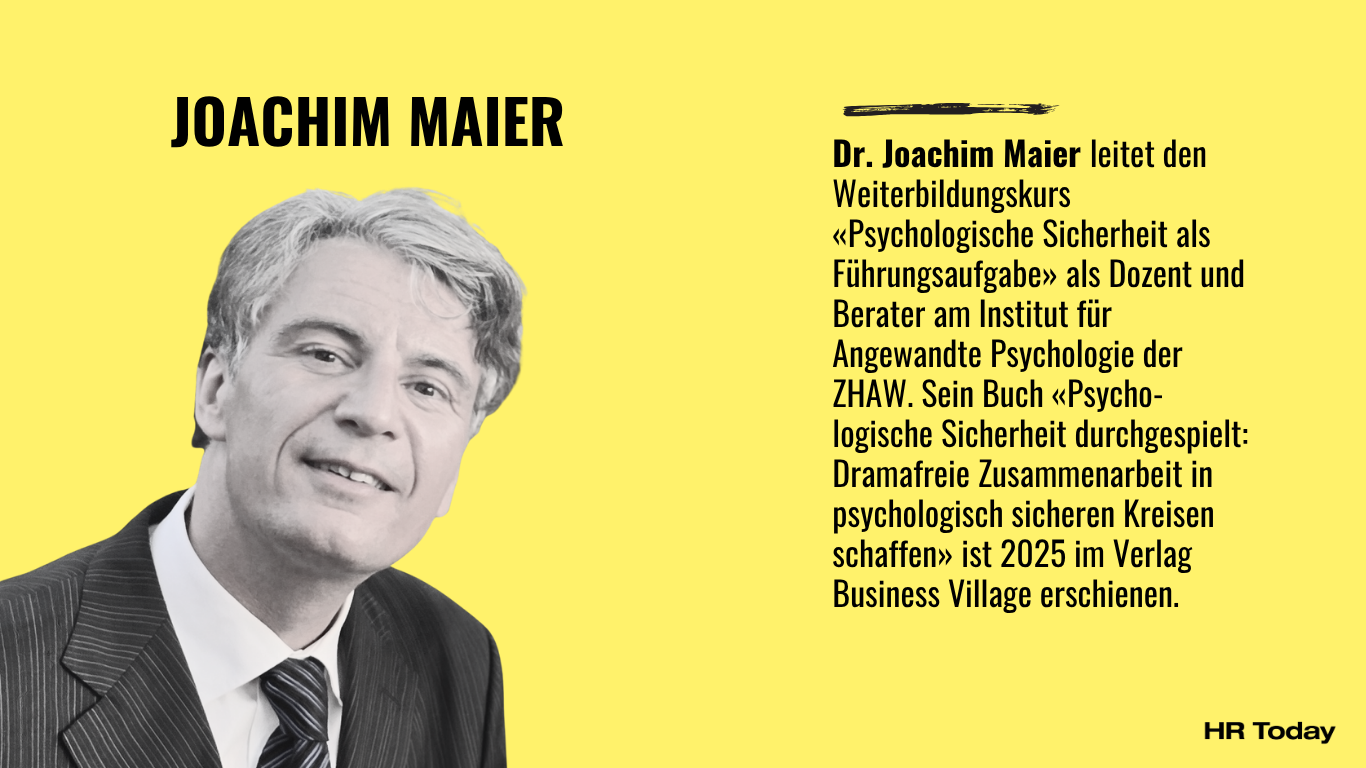
Sie versprechen einen Lernpfad zur «dramafreien Zusammenarbeit». Was verursacht dieses Drama im Arbeitskontext überhaupt?
Kurz gesagt gilt: Je mehr individuelles Drama und Defensivreaktionen – ganz klassisch Fight, Flight, Freeze und Fawn – sich im Team zeigen, desto geringer sind dessen psychologische Sicherheit und Performance ausgeprägt. Wie bereits gesagt, entstehen Defensivreaktionen als unwillkürliche Schutzmechanismen des Nervensystems, wenn Einzelne sich unsicher, gestresst und angsterfüllt fühlen. Diese Schutzreaktionen zeigen sich bei einem Stresslevel ausserhalb des Toleranzfensters – dem individuell optimalen Erregungsbereich zwischen Unbeweglichkeit und Chaos –, in dem Menschen handlungsfähig, emotional ausgeglichen und sicher verbunden bleiben können. Ein im Buch ausgeführter Schlüssel zur dramafreien Zusammenarbeit sind psychologisch sichere Kreise – das sind kleine, oft überlappende Teamkonstellationen, in denen Zusammenarbeit noch gelingt, weil sie genügend sicherheitsstiftende Verbundenheit bieten, damit Defensivreaktionen überflüssig bleiben. Zurück zur Frage: Drama entsteht auch durch den Anspruch, dass alle im Team in einem grossen, sicheren Kreis zusammenarbeiten können müssten. Diesen einen sicheren Kreis ist ausserhalb von Glaubensgemeinschaften und militärischen Spezialeinheiten meist ebenso unrealistisch wie wenig wünschenswert: Denn unterschiedliche Bedürfnisse, Sensibilitäten und Perspektiven im Team sind Fundament für gelingende Lernprozesse.
Die vorhin von Ihnen zitierte Google-Studie betont den angstfreien Umgang miteinander als zentralen Erfolgsfaktor. Ist das – im Jahr 2025 – nicht eigentlich eine triviale Erkenntnis?
Genau: Seit Googles Aristoteles-Studie und unzähligen Folgeforschungsarbeiten gilt psychologische Sicherheit als stärkster Prädiktor für gelingende Team-Performance. Auf klassische Teamentwickler wirkt die Erkenntnis durchaus provokativ, dass die Art und Weise der Zusammenarbeit erfolgsrelevanter sei als die Teamzusammensetzung – und das, nachdem man 50 Jahre lang versucht hatte, mit Belbin-, DiSC- oder anderen Alpha-, Beta- und Gamma-Rollenmodellen zum Teamerfolg beizutragen. Offenbar waren diese Versuche wenig evident. Und ja, diese Erkenntnis ist intuitiv nachvollziehbar für viele, aber mitunter nicht trivial für Entscheidungsträger. Ein Blick auf die zentrale Bedeutung der psychologischen Sicherheit in meiner Beratungstätigkeit lässt die Erkenntnis – die Art der Zusammenarbeit sei wichtiger als die Teamzusammensetzung – vielfach aus Sicht der Mitarbeiter zwar trivial erscheinen, birgt allerdings für Entscheider oft überraschende Erkenntnisse, weil Führungskräfte zuverlässig dazu neigen, sowohl das Niveau der psychologischen Sicherheit im Team, als auch den eigenen positiven Einfluss darauf systematisch zu überschätzen. Dieses Delta, diese Blindheit zwischen Selbst- und Fremdbild lässt sich messen, besprechen und bei der Arbeit in Teams erfahrbar machen. Vielleicht noch dies: Selbst in toxischen Teams führt schon eine sicher verbundene Person zu einer deutlichen Verbesserung der Performance. Und: Tatsächlich wirkt die Führungskraft nur in wenigen Teams besonders integrierend.
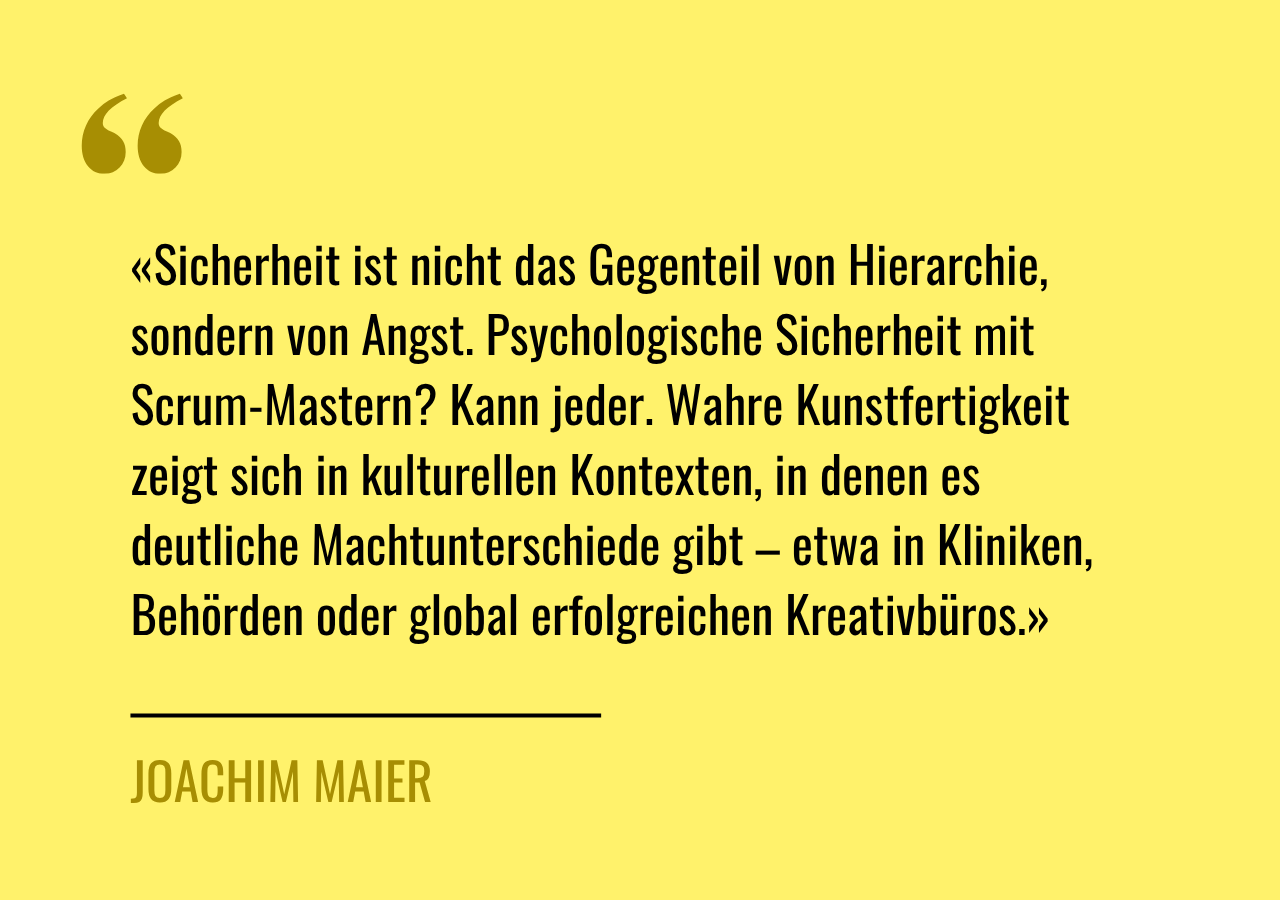
Sie zitieren die Harvard-Professorin Amy Edmondson: Psychologische Sicherheit bedeute sich offen und aufrichtig einbringen zu können, ohne Angst vor Beschämung, Abweisung oder negativen Sanktionen haben zu müssen. Aber arbeiten nicht viele hierarchische Firmen genau mit solchen Mechanismen?
Zuerst einmal: Psychologische Unsicherheit ist nicht zwingend an Hierarchie gekoppelt. Mir sind psychologisch sichere und hochperformante Teams mit dem Reifegrad «Mafia» oder «Militär» genauso begegnet wie prekäre und angsterfüllte Teams mit dem Reifegrad Familie oder Organismus. Sicherheit ist nicht das Gegenteil von Hierarchie, sondern von Angst. Führungsstile, offen deklariert als «Management by Terror», Micromanagement oder Hands-on-Management – mit dem Finger im Teig, bis sich etwas bewegt – sind zwar vielerorts Auslaufmodelle, erfordern allerdings besondere Massnahmen zur Stärkung der matchentscheidenden psychologischen Sicherheit. Oder pointiert: Psychologische Sicherheit mit Scrum-Mastern? Kann jeder. Wahre Kunstfertigkeit zeigt sich in kulturellen Kontexten, in denen es deutliche Machtunterschiede gibt – etwa in Kliniken, Behörden oder global erfolgreichen Kreativbüros. Und: In der Praxis hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass in angstfreien Organisationen Elefanten im Raum und Schlangen unter dem Teppich eher angesprochen werden – und damit dringend nötige Lernprozesse gelingen können. Ja, vielerorts wird die angstfreie Organisation – trotz häufig bestem Willen aller Beteiligten – noch nicht zuverlässig gepflegt, weil die dazu nötigen Hebel zu wenig bekannt, zu wenig geschult und auf Teamebene zu selten gemessen werden. Hier schliesst sich der Kreis zur ersten Frage: Ja, psychologische Sicherheit wird mancherorts noch zu wenig gelebt – obwohl fast alle Beteiligten ein Bedürfnis nach dramafrei gelingender Zusammenarbeit haben und die Erfolgsträchtigkeit ausser Frage steht. Diese Lücke – das Sicherheitsbedürfnis der Mitarbeitenden mit dem Erfolgsbedarf der Organisation zu verbinden – sucht «Psychologische Sicherheit durchgespielt» zu schliessen. Vielleicht noch dies: Psychologische Sicherheit ist kein Selbstzweck – sie ist die Basis für eine Zusammenarbeit, die nicht nur dramafrei, sondern auch sozial nachhaltig und erfolgreich ist.

