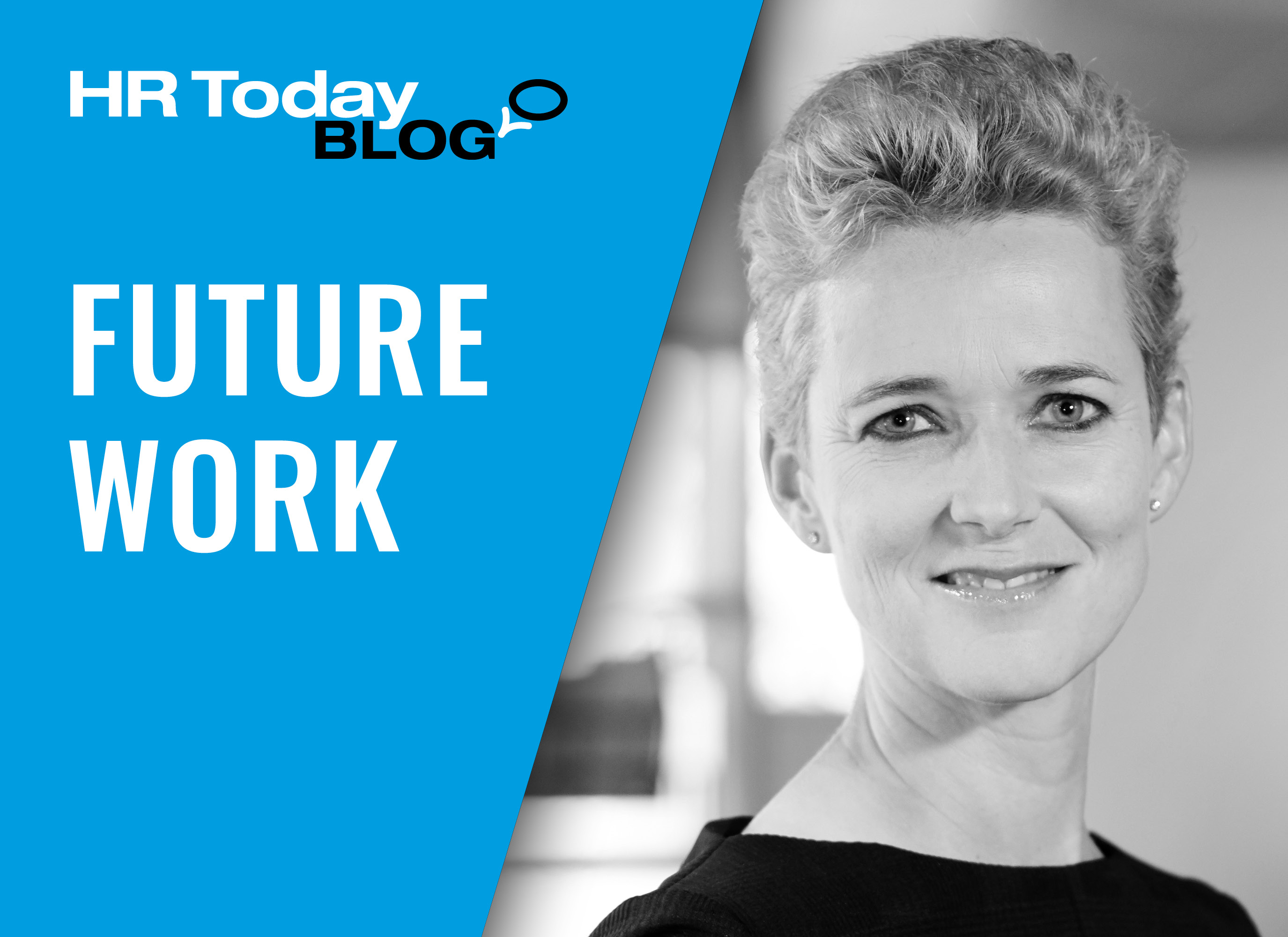Stellen Sie sich vor, Sie «müssten» für einen Tag aus Ihrer Berufung ausbrechen. Wohin würden Sie gehen und was würden Sie tun?
Anselm Grün: Das wäre für mich eine absolute Identitätskrise. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun – und habe es nie bereut, diesen Weg eingeschlagen zu haben.
Sie besitzen langjährige Führungserfahrung. Oft wird von «dienender Führung» gesprochen. Was bedeutet das für Sie?
Dienen darf nicht moralisierend verstanden werden. Es geht nicht darum, sich aufzuopfern, sondern um Sinn und Ausrichtung. Ich stelle meine Fähigkeiten in den Dienst des Lebendigen, des Gelingens – bei mir selbst, bei den Mitarbeitenden und in der Organisation. Natürlich diene ich auch mir selbst. Es wäre falsch, das auszublenden. Aber wenn ich nur meine Macht inszeniere, verliere ich die Verbindung. Manche Führungskräfte sammeln in ihren Abteilungen geradezu «Bewunderungszwerge» um sich. Wer sie nicht bewundert, fliegt raus. Das ist nicht dienen. Das ist narzisstisch motivierte Machtsicherung.
Wie hat sich das Führungsverhalten in den letzten Jahrzehnten verändert?
Gerade im Mittelstand spüre ich, dass die emotionale Bindung an Unternehmen deutlich abgenommen hat. Früher war man stolz, für ein Unternehmen zu arbeiten. Man blieb, war loyal, identifizierte sich mit dem, was man tat. Heute ist das anders. Der Individualismus ist stärker geworden. Viele Menschen fragen: Was bringt mir das konkret für mein Leben? Das stellt Führung vor neue Herausforderungen. Es braucht mehr Sinnstiftung, mehr echte Verbindung und weniger Kontrolle.
Wie sehen Sie grundsätzlich die aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt – problematisch oder voller Chancen?
Heute ist viel von Work-Life-Balance die Rede. Viele wollen nicht nur arbeiten, sondern auch leben. Das ist nachvollziehbar. Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass Arbeit als etwas Negatives wahrgenommen wird, als notwendiges Übel. Dass das eigentliche Leben erst nach Feierabend beginnt. Dabei ist Arbeit ja ebenfalls ein Teil des Lebens. Deshalb bin ich vorsichtig mit dieser klaren Trennung zwischen Arbeit und Leben. Es braucht eine neue Wertschätzung dafür, was Arbeit sein kann.
Viele Menschen scheitern derzeit an den Anforderungen des Systems. Was braucht es, um innerlich nicht auszubrennen?
Wer Verantwortung trägt, braucht einen inneren Ort der Ruhe. Darum ist es wichtig, dass man sich heilige Zeiten schafft – Zeitfenster, die einem ganz allein gehören.
Was raten Sie konkret?
Das kann ganz Unterschiedliches sein und muss nicht religiös geprägt sein. Beispielsweise kann man sich einfach bewusst eine Stunde Zeit für sich nehmen, spazieren gehen oder in Ruhe frühstücken. Entscheidend ist: Ich schaffe mir einen Raum, der nur mir gehört.
Was waren in all den Jahrzehnten Ihre wertvollsten Ratschläge an Führungskräfte?
Gute Führung beginnt mit Selbsterkenntnis. Wer sich selbst nicht kennt, trägt innere Konflikte nach aussen – oft unbewusst. Der Psychiater C. G. Jung nannte das «Schattenarbeit»: Alles, was wir an uns selbst nicht wahrhaben wollen, projizieren wir auf andere. Ein zweiter, oft vernachlässigter Aspekt ist die Frage nach der eigenen Kraftquelle. Viele Führungskräfte orientieren sich an Idealbildern: durchsetzungsstark, entscheidungsfreudig und konfliktfähig. Doch diese Bilder sind häufig fremdbestimmt und energieraubend.
Die entscheidende Frage lautet deshalb: Woher nehme ich meine Kraft? Die Antwort liegt oft in der Kindheit. Was haben wir als Kinder leidenschaftlich gern getan? Und wie lässt sich dieses Element in den Berufsalltag integrieren?
In Führungstrainings lasse ich Teilnehmende darüber sprechen, was sie als Kinder begeistert hat und was davon sich im heutigen Beruf wiederfinden lässt. Die Wirkung ist verblüffend: Freude kehrt zurück. Menschen erkennen, dass sie nicht einem Idealbild entsprechen müssen. Sie dürfen mit ihrer Persönlichkeit führen.
Eine weitere Quelle innerer Stärke ist der Sinn. Welche Hoffnung vermittle ich durch meine Arbeit? Wer spürt, dass er Hoffnung stiftet, schöpft Energie. Klar, Hoffnung ist kein betriebswirtschaftlicher Strategiebegriff. Doch Strategie allein bewegt nichts. Hoffnung dagegen ist emotional. Sie inspiriert.
Das komplette Interview mit Anselm Grün erschien im HR Today-Schwestermagazin Miss Moneypenny.