Das Immunsystem von Unternehmen
Unsicherheit prägen Politik und Wirtschaft. Globale Krisen und geopolitische Spannungen erhöhen den Druck mit spürbaren Folgen für die Arbeitswelt – und damit auch den Druck auf die Art und Weise von Führung.

Die Balance zwischen Kontrolle und Offenheit ist entscheidend für die Resilienz von Organisationen. (Bild: ChatGPT)
In den letzten Monaten scheint ein «alter» neuer Trend in der Führungskultur von Organisationen Einzug zu halten. Es wächst der Wunsch nach klaren Vorgaben und einer «starken Hand» in Form eines direktiven oder sogar autoritären Führungsstils.
Autoritäre Führung als kurzfristiger Stabilisator
Ein solcher Stil kann in Krisensituationen schnell klare Orientierung geben und kurzfristig Stabilität schaffen¹. Mittel- und langfristig aber schwächt er genau das, was Organisationen in Krisenzeiten widerstandsfähig macht: psychologische Sicherheit. Psychologische Sicherheit beschreibt dabei den Grad, zu dem sich Mitarbeitende am Arbeitsplatz sicher fühlen, zwischenmenschliche Risiken einzugehen, sich also zum Beispiel mit unkonventionellen Ideen, kontroversen Meinungen und so weiter zu exponieren und sich schlussendlich zu trauen, so zu sein, wie sie wirklich sind.
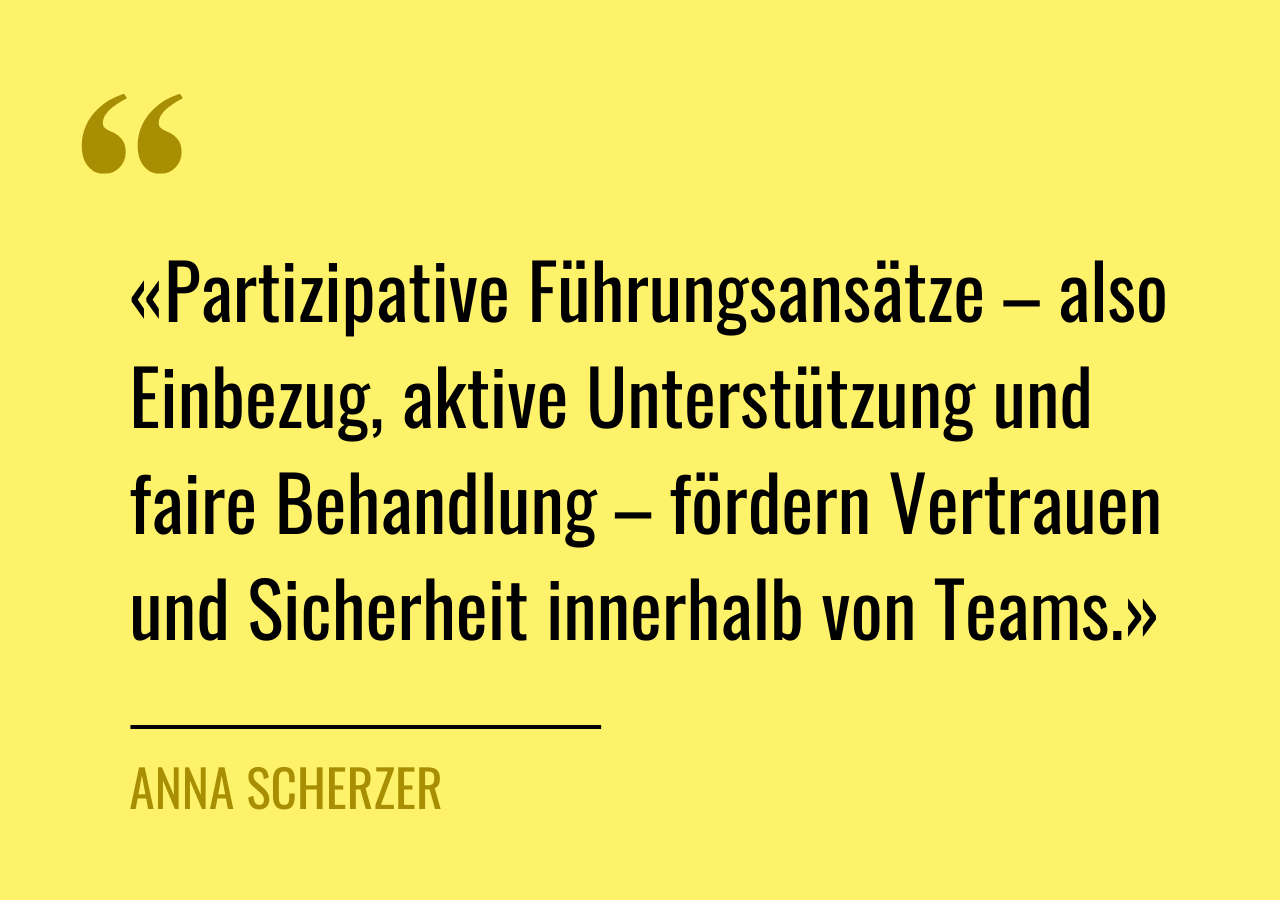
Studien zeigen in diesem Kontext, dass sich autoritäre, direktive Führungsstile mit der Zeit signifikant negativ auf Faktoren wie Engagement, Motivation und Innovationskraft² von Mitarbeitenden auswirken. Gleichzeitig reduzieren entsprechende Führungsstile das Vertrauen in die Führung sowie den Willen von Mitarbeitenden, sich für die Organisation einzusetzen.³
Denn wer sich längerfristig in seinem Entscheidungsspielraum eingeschränkt und kontrolliert fühlt, hält sich mit Inputs und Ideen zurück. Mitarbeitende vermeiden es, Fehler zu benennen oder kritische Punkte anzusprechen – genau dann, wenn Transparenz und gemeinsames Lernen am wichtigsten wären. Das Bedürfnis nach Kontrolle kann damit unbeabsichtigt zu einer Kultur des Schweigens führen. Der kurzfristige Gewinn an Ordnung wird mit einem langfristigen Verlust an Offenheit bezahlt.
Psychologische Sicherheit als Grundlage von Resilienz
In Zeiten von Unsicherheiten und Krisen sind Offenheit und Mitgestaltung für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation jedoch langfristig unverzichtbar. Es braucht gemeinsame Kraftanstrengungen, fest zusammenstehende Teams und am Ende des Tages resiliente Organisationen, die als Einheit durch Krisen gehen.
Dabei spielt psychologische Sicherheit eine wichtige Rolle, denn sie steigert den Zusammenhalt von Mitarbeitenden und lässt sie häufiger Ideen einbringen. Sie erhöht die Bereitschaft, in Krisen nötige Massnahmen mitzutragen und vor allem positiver durch Krisen zu gehen.⁴
Dies bestätigt sich auch in einer repräsentativen Arbeitsmarktstudie von Avenir, in der über 1000 Schweizer Arbeitnehmende befragt wurden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen einen signifikant positiven Einfluss von psychologischer Sicherheit auf die Vernetzung der Mitarbeitenden innerhalb einer Organisation, den Informationsaustausch untereinander sowie die gegenseitige Unterstützung bei der Arbeit. Zusätzlich ist ein positiver Effekt von psychologischer Sicherheit auf das Engagement und die Zufriedenheit von Mitarbeitenden feststellbar.
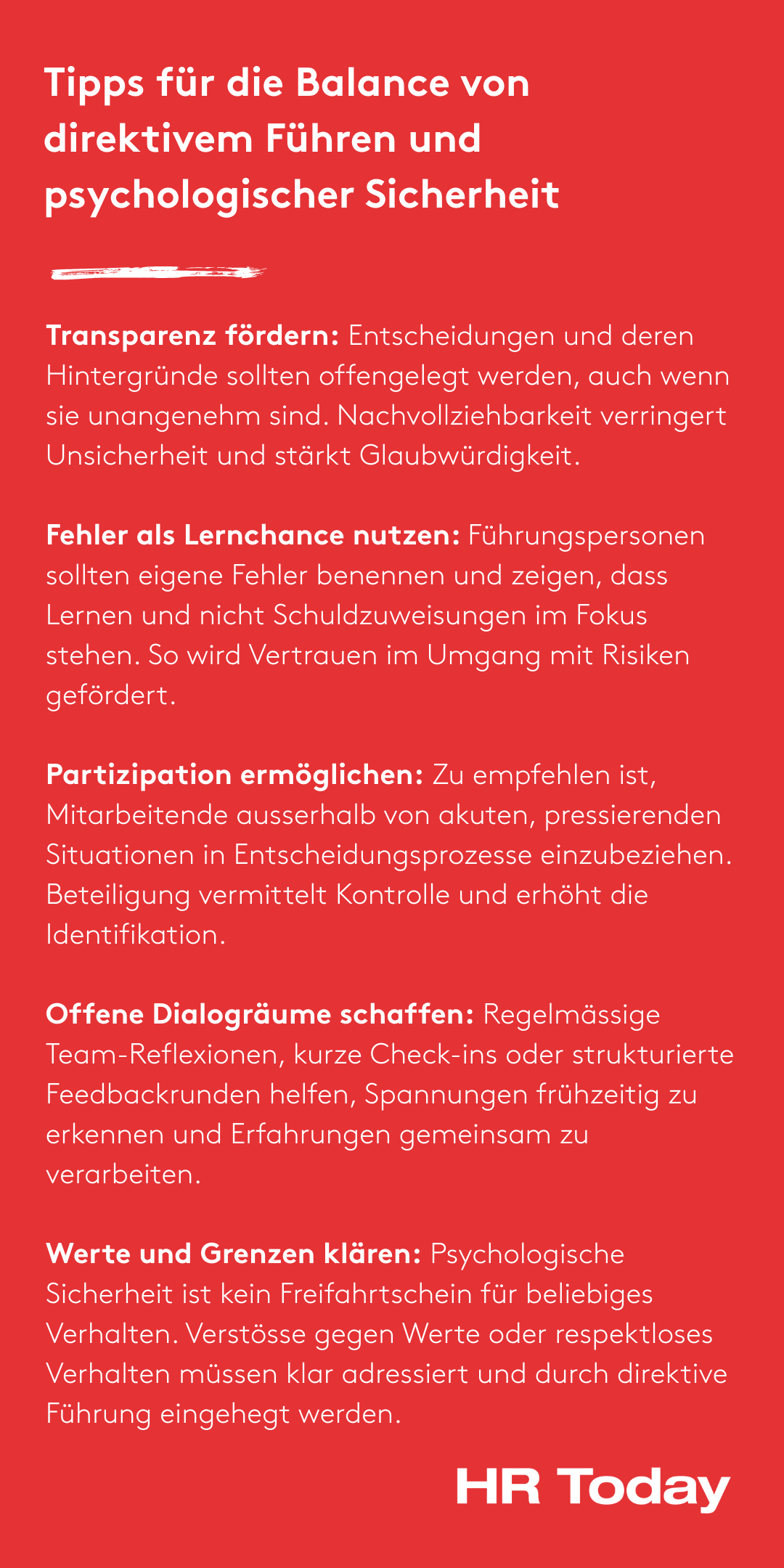
Im Kontext multipler Krisen gewinnt das Konzept von psychologischer Sicherheit damit an besonderer Bedeutung. Denn insgesamt bleiben Teams mit hoher psychologischer Sicherheit auch bei Unsicherheit handlungsfähig. Sie können Spannungen aushalten, lernen aus Fehlern und passen sich an neue Gegebenheiten an. Psychologische Sicherheit funktioniert damit wie ein Immunsystem: Sie schützt die Organisation vor innerer Lähmung und ermöglicht, auf äussere Schocks flexibel zu reagieren. Sie steigert die Resilienz von Mitarbeitenden und Organisationen in Krisen.⁵
Wie psychologische Sicherheit gestärkt werden kann
Wie also kann psychologische Sicherheit gestärkt werden? Partizipative Führungsansätze – also Einbezug, aktive Unterstützung und faire Behandlung – fördern Vertrauen und Sicherheit innerhalb von Teams. Die von Avenir durchgeführte Studie zeigt, dass Führungspersonen dann eine besonders positive Auswirkung (einen signifikanten Einfluss) auf die psychologische Sicherheit in ihrem Einflussbereich haben, wenn sie zuhören (das heisst offen sind für Hinweise, Anregungen und konstruktive Kritik), Perspektiven einbeziehen (Ideen schätzen) und Verantwortung teilen (das heisst Mitarbeitende bei Entscheidungen einbeziehen). So schaffen sie durch ihr Verhalten die Grundlage für psychologische Sicherheit.
Hintergrund der Studie
Avenir befragt in regelmässigen Abständen Schweizer Arbeitnehmende, um Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu verfolgen und Arbeitgebende dabei zu unterstützen, sich diesen zu stellen und sie optimal zu nutzen. Dafür wurde zuletzt im Februar 2025 eine repräsentative Stichprobe (nach Geschlecht, Alter und Region) von über 1000 Arbeitnehmenden zur Wahrnehmung ihrer Arbeitssituation befragt.
Doch psychologische Sicherheit heisst nicht, dass sich alle so verhalten können und dürfen, wie sie es gerade möchten. Auf Organisationsebene braucht psychologische Sicherheit ein stabiles Fundament und Verhaltenseckpfeiler. Sie entsteht dort, wo gemeinsame Werte gelebt, Diskussionen konstruktiv geführt und klare Grenzen für unethisches Verhalten gezogen werden. Kultur und Strukturen bilden das Fundament; darauf aufbauend sorgt die Führung dafür, dass das Fundament im Alltag spürbar wird.
Führung zwischen Durchgriff und Vertrauen
Krisen stellen Führungspersonen damit vor ein Spannungsfeld: Einerseits sind schnelle und unpopuläre Entscheide notwendig, um Schaden abzuwenden. Andererseits darf der notwendige Durchgriff die psychologische Sicherheit nicht zerstören, die für die Zeit danach entscheidend ist.
Hier ist eine situative Balance gefragt. In kritischen Momenten braucht es direktives Handeln, um Klarheit zu schaffen. Anschliessend muss Raum für Einbindung, Kommunikation und Reflexion entstehen. Gute Führung erkennt, wann Durchgriff nötig ist – und wann Zuhören, Dialog und Beteiligung den grösseren Beitrag leisten.
Fazit: Die richtige Mischung macht es
Autoritäre, direktive Führung hat definitiv ihren Platz im Führungsalltag – vor allem in Krisenzeiten. Als dauerhaftes Führungsprinzip jedoch birgt sie Risiken: Sie hemmt Vertrauen, Engagement und Innovationskraft. Organisationen, die langfristig erfolgreich sein wollen, brauchen Führung, die beides kann – klare Entscheidungen treffen und gleichzeitig psychologische Sicherheit fördern.
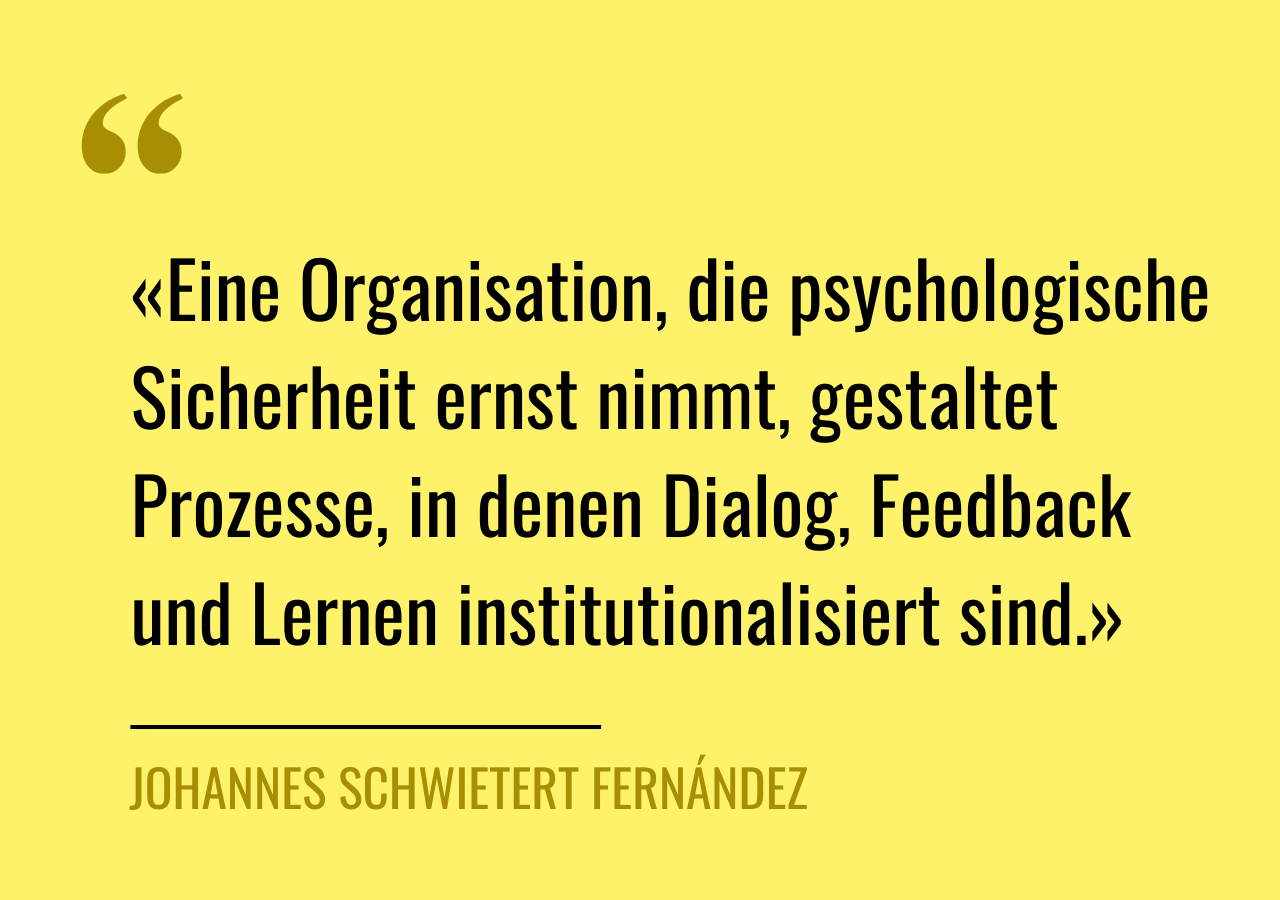
Auch auf kultureller Ebene sind Investitionen nötig. Eine Organisation, die psychologische Sicherheit ernst nimmt, gestaltet Prozesse, in denen Dialog, Feedback und Lernen institutionalisiert sind. Sie schafft Strukturen, die es erlauben, Fehler zu analysieren, ohne Schuldige zu suchen. Und sie achtet darauf, dass Leistungsdruck nicht die Grundlage für Vertrauen und Offenheit untergräbt.
Denn psychologische Sicherheit ist kein «weiches» Thema, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor. Sie entscheidet darüber, ob Teams in Krisen verstummen oder zusammenhalten, ob Individuen Angst haben – oder den Mut, gemeinsam zu handeln.
So verstanden ist psychologische Sicherheit tatsächlich das Immunsystem moderner Organisationen: unsichtbar, aber lebenswichtig.
Quellen
¹ Rosing, F., Boer, D. & Buengeler, C. (2022); «When timing is key: How autocratic and democratic leadership relate to follower trust in emergency contexts»; Frontiers in Psychology, 13.
² Mehraein, V., Visintin, F. & Pittino, D. (2023); «The dark side of leadership: A systematic review of creativity and innovation»; International Journal Of Management Reviews, 25(4), 740–767.
³ Chiang, J. T., Chen, X., Liu, H., Akutsu, S. & Wang, Z. (2020); «We have emotions but can’t show them! Authoritarian leadership, emotion suppression climate, and team performance»; Human Relations, 74(7), 1082–1111.
⁴ Gevorgyan, A. (2024); «The role of psychological safety in the perception of organizational crisis by employees»; Modern Psychology, 7(2(15)), 03–11.
⁵ Edmondson, A., Bahadurzada, H. & Kerrissey, M. (2024) «Psychological Safety as an Enduring Resource Amid Constraints»; International Journal Of Public Health, 69.




