Das KI-Wettrüsten im Jobdschungel
Künstliche Intelligenz löst Probleme, die sie selbst erzeugt hat. Die Lösung ist darum nicht das nächste Feature, sondern grundlegendes Vertrauen – im Recruiting eine zentrale Ressource, die im KI-Zeitalter zunehmend erodiert. Warum das den Arbeitsmarkt erschüttert.
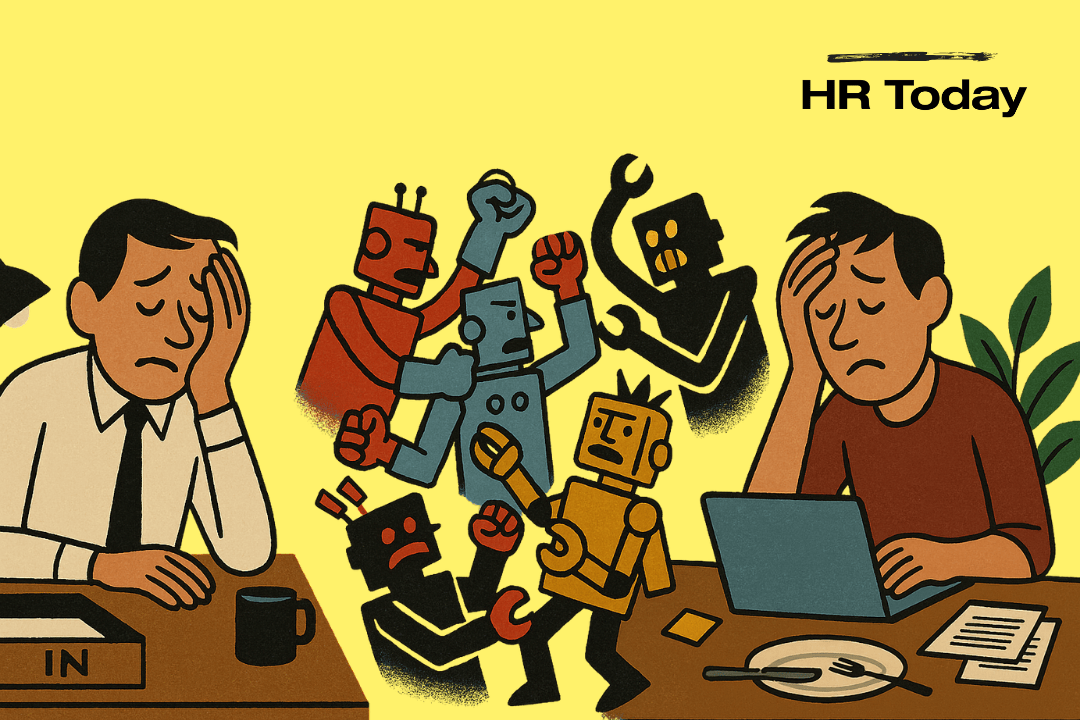
KI kreiert Probleme, die wiederum mit KI gelöst werden sollen – ein gegenseitiges Wettrüsten. (Bild: ChatGPT / Canva)
Vielleicht sollten wir zu Beginn eine völlig falsche Frage stellen:
Was, wenn wir dereinst nicht mehr wissen: Ist das jetzt KI-generiert oder steckt da wirklich ein Mensch dahinter?
Was, wenn dieses Bild nicht echt ist? Was, wenn jenes Video gar nicht der Realität entspringt? Was, wenn der CV und das Bewerbungsschreiben auf meinem Tisch nur KI-generiert sind? Zählen wir doch die Finger – das kann KI nicht. Achten wir auf Gedankenstriche, denn die macht ChatGPT doch ständig. Lassen wir doch Texte durch KI-Detektoren analysieren, die erkennen das hoffentlich. Das sind vielleicht keine schlechten Antworten. Aber auch wenn sie wirklich gut wären, bringt es nichts, wenn das Problem nicht in der Antwort, sondern bei der Frage liegt.
Zwischen den Zeilen gibt uns diese Frage aber dennoch einen Hinweis auf das eigentliche Problem. Es ist: der Zweifel. Was die Frage begründet: der Verdacht. Es ist dasselbe Problem, das wir aus Beziehungen kennen, in denen aus Misstrauen das Bedürfnis entsteht, vielleicht doch einmal den WhatsApp-Verlauf des Gegenübers nach möglichen Spuren der Untreue zu durchkämmen. Aber was, wenn da vielleicht Nachrichten gelöscht und die Untaten vertuscht wurden? Das Problem ist hier – vielleicht denken Sie das jetzt in diesem Moment – nicht die potenzielle Untreue, sondern die Tatsache, dass so ein Verdacht – und der Ansatz, die Lösung im Kontrollbedürfnis zu suchen – nur entstehen kann, wenn etwas fehlt oder bereits abhanden gekommen ist: Vertrauen.
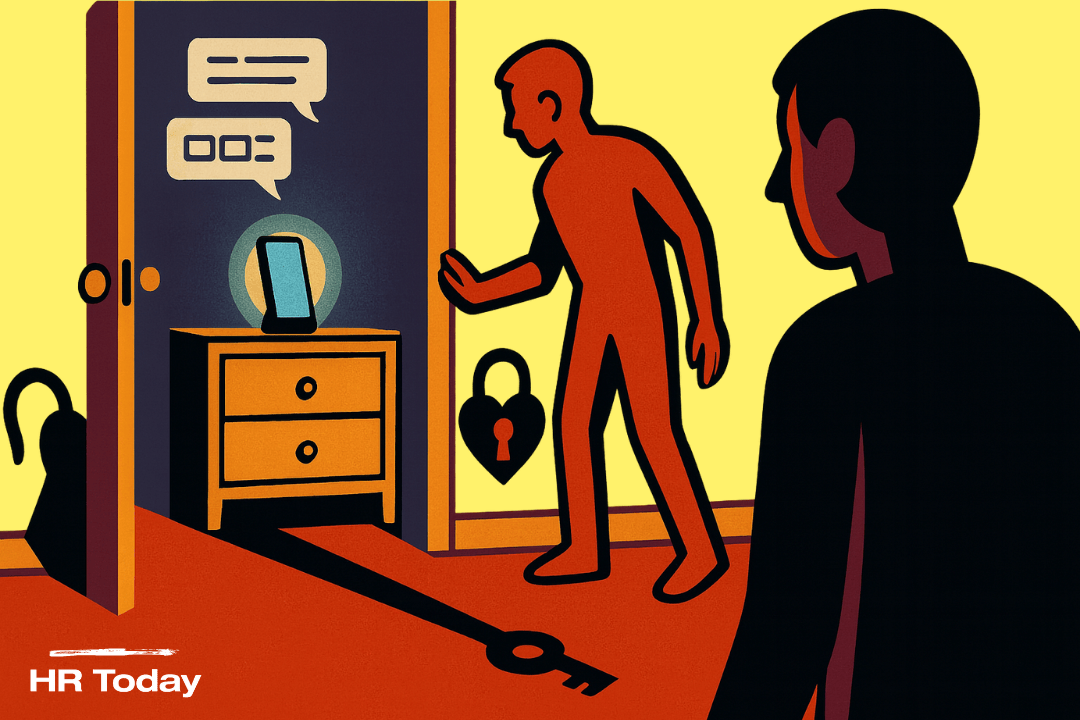
Wenn das Vertrauen erst zerbrochen ist, wird es schwer, sie wiederherzustellen. (Bild: ChatGPT / Canva)
Das Problem mit KI ist nicht, dass wir vielleicht dereinst kaum mehr zwischen Mensch und Maschine unterscheiden können. Das Problem ist jetzt schon da, der Zweifel ist gesät, das Misstrauen irgendwo im Hinterkopf, der Verdacht geschürt und das Vertrauen zerbrochen.
KI hat unser Vertrauen längst angegriffen – und die Schäden sind überall spürbar. Von persönlichen Beziehungen bis in die Politik. Und besonders fruchtbarer Nährboden für Misstrauen findet sich dort, wo systemische Spannungsverhältnisse bestehen.
Der Plattformzerfall als Geschäftsmodell der Zukunft
Besonders greifbar wird dieses Prinzip auf dem Jobmarkt: Arbeitsuchende, Arbeitgebende und dazwischengeschaltete Jobplattformen haben Interessen, die auf den ersten
Blick gleich klingen: Effizienz, Reichweite, Kompatibilität.
Aber genau weil alle dieselben Interessen verfolgen, geraten sie in Konflikt. Unternehmen streben möglichst viel Profit mit möglichst wenig Investment an – genau wie die andere Seite: möglichst wenig Aufwand, möglichst effizient, möglichst viele Bewerbungen und daraus resultierende attraktive Jobangebote. Die Plattformen dazwischen hingegen haben ein Interesse daran, beide Seiten so lange wie möglich in ihrem Ökosystem zu halten, weil sich dieses nur so weiter monetarisieren lässt. Wenn die angestrebte Effizienz der einen Seite im Widerspruch zur Effizienz der anderen Seite steht, führt das paradoxerweise zur Produktion kollektiver Ineffizienz.
Während Jobplattformen wie Indeed – und mittlerweile auch LinkedIn – ursprünglich eine schlichte Vermittlungsfunktion hatten, stehen sie nun in einer Gatekeeperrolle mit immer stärker werdenden, eigenen wirtschaftlichen Interessen und einem eigenen, komplexen Ökosystem. Anfänglich haben sie bloss eine Lücke gefüllt, die durch den Siegeszug des Internets offensichtlich geworden ist. Aber auch das hat Probleme mit sich gebracht.
Der Netzaktivist und Autor Cory Doctorow hat Anfang 2023 für das Tech-Magazin «The Verge» einen längst zum Klassiker gewordenen Essay verfasst: «The Enshittification of TikTok». Darin beschrieb er ein Phänomen, das auch «Plattformzerfall» («platform decay») genannt wird.

Er analysierte, wie insbesondere Social-Media-Plattformen – bekanntlich Unternehmen, die ewig keinen Profit machen, aber durch Venture Capital astronomische Bewertungen auf Papier erreicht haben – schrittweise schlechter werden. Das geschieht gemäss Doctorow in der Regel sobald diese Plattformen eine kritische Masse erreicht haben. Um den Profit zu maximieren, werden die anfänglich frei zugänglichen und angenehm designten Plattformen monetarisiert und algorithmisch verändert, um nicht etwa die Qualität des Produkts, sondern das Engagement zu steigern. Da die kritische Masse erreicht ist, fällt es den Userinnen und Usern aber schwer, die Plattformen ganz zu verlassen oder auf eine andere Plattform zu wechseln. Jobplattformen haben dasselbe Problem.
Sie vermitteln nicht mehr nur, sondern sie verkaufen ihren Nutzenden auf beiden Seiten neue Zusatzfeatures, mit denen die Jobsuche einfacher werden soll – oder packen einst kostenlose Funktionen hinter eine Bezahlschranke. Kurz: Sie verlangen Geld für Sichtbarkeit. In gewisser Weise machen sie die Jobsuche also nicht einfacher, sondern schwieriger – und kostspieliger. Nicht zuletzt, weil sich dieser Markt durch das Aufkommen diverser Jobplattformen fragmentiert hat – ähnlich wie bei Streamingangeboten. Und auch, weil manche Unternehmen ihre Jobangebote aus Kostengründen nur auf einer statt mehreren Plattformen veröffentlichen oder sogar ganz darauf verzichten. Der Jobmarkt als Dschungel.
Das Internet und die Unternehmen, die innerhalb dieses technologischen Ökosystems und ihrer wirtschaftlichen Logik operieren, haben somit den bereits bestehenden Widerspruch einerseits sichtbarer gemacht, andererseits aber auch verschärft: Wer sich in den sozialen Medien umschaut, findet Unmengen an Geschichten, in denen sich alles um den Frust der Jobsuche auf dem modernen Arbeitsmarkt dreht.
Disruption ist nicht automatisch ein Gleichmacher
Dass KI nicht nur einfach Innovation ist, sondern erhebliches disruptives Potenzial hat, ist schon fast eine Binsenweisheit. Was das aber bedeutet, darüber reden wir zu wenig: Disruption heisst hier nicht einfach, dass aus Irritationen schliesslich neue Lösungen entstehen. Sondern, dass bestehende Prozesse und Machtstrukturen radikal in Frage gestellt werden.
Der Wert von Texten etwa ergibt sich aus dem personellen und zeitlichen Aufwand – und aus der Tatsache, dass Menschen, die gut schreiben können, tendenziell selten sind. ChatGPT aber hebelt dieses Prinzip aus: Texte werden in Sekunden generiert, die Nachfrage nach Textproduzentinnen und Textproduzenten sinkt, Texte verlieren an Wert. Plötzlich haben also unzählige Menschen Zugang zu etwas, was zuvor rar war – und das enorm kostengünstig.
Das Gleiche gilt für allerlei Gedankenarbeit vom Programmieren bis zum Produzieren von Marketingstrategien. In dieser Hinsicht also geben uns KI-Tools enorme Macht, die zuvor ungleich verteilt war. Das kostet nicht nur Jobs oder zumindest Jobprofile, sondern verändert auch fundamental Prozesse, die sich über lange Zeit verselbstständigt haben – so auch das Recruiting. Teile dessen, was manche im Diskurs um KI als neu empfinden, ist jedoch bereits Realität. Darum zielen viele Diskussionsbeiträge am eigentlichen Punkt vorbei. Der Jobmarkt ist durch die Plattformen bereits algorithmisiert. Menschen schreiben für Algorithmen – statt für Menschen am anderen Ende.
Dass Arbeitnehmende angesichts der Wirren des Jobdschungels, der Machtasymmetrie zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden und der ökonomischen Prinzipien im Hintergrund auf KI zugreifen, um ihre Arbeitssuche effizienter zu gestalten, ist eigentlich nur konsequent. Es ist, als hätten Firmen wie OpenAI, Anthropic oder Google den Arbeitnehmenden plötzlich eine Waffe gegeben, mit denen der Konflikt, in dem sie stehen, vermeintlich etwas gleicher wird. Das wiederum bringt Arbeitgebende und insbesondere Recruiting-Abteilungen ins Schwimmen. KI-generierte Bewerbungen häufen sich, der Bearbeitungsaufwand steigt. Dieses Wechselspiel zeigt auch auf: KI-Tools wenden sich nicht gegen «das System». Sie spielen das Spiel mit – und das intensiviert.
Diese Dynamik erinnert frappant an die 1990er- und 2000er-Jahre. Das Internet setzte sich, im Vergleich zu anderen Technologien, rasant durch. CD-Verkäufe brachen ein, denn plötzlich brauchte es CDs nicht mehr.
Wozu noch ein Datenträger, wenn das, was er trägt, auch durch das Internetkabel fliessen kann? Ohne Musikladen kein Vertrieb. Ohne CD keine Einnahmen. Plötzlich lässt sich Musik grenzenlos kopieren und teilen. Der Wert sinkt – von CDs, aber auch von Musik.
Um dem entgegenzuwirken und die einbrechenden Verkäufe zu stabilisieren, werden Massnahmen für den Kopierschutz entwickelt, die sich bald durchsetzen, bei Musik, Software – überall. Das wiederum liessen sich viele Menschen nicht bieten und entwickelten ihrerseits Methoden, um die neuen Hindernisse zu umgehen und die Schlösser zu knacken. Bis heute dauert dieses Hin und Her an. Auf den Crack folgen neue Kopierschutzmassnahmen, folgen neue Cracks, folgen neue … Mit anderen Worten: Es ist ein stetes Wettrüsten.
Auf jede Lösung folgt das nächste Problem
Ein ähnlicher Kalter Krieg kommt nun auf den Jobmarkt zu. Die Waffen der Aufrüstung: KI-Tools. Die Waffen, um gegen diese Tools anzukommen? Ebenfalls KI-Tools. Im Grunde löst man hier also Probleme mit KI, die überhaupt erst durch KI entstanden sind. Zum Beispiel: Final Round AI. Die Software fungiert als eine Art KI-Teleprompter, der das Videointerview live transkribiert und Antworten vorschlägt – inklusive Hinweisen zu angebrachter Tonalität. Hat Ihr Bewerber tatsächlich Ahnung von dem, was er sagt? Wer weiss.
Dagegen ankämpfen könnte man beispielsweise mit Psicosmart. Die Software analysiert Mimik, Gestik und Stimme der bewerbenden Person und soll so dem Verborgenen auf die Schliche kommen. Falls Ihnen das zu weit geht, nutzen Sie doch Tactiq. Das ist quasi der Teleprompter für die HR-Seite.
Ihr Unternehmen hat eine Stellenanzeige von herkömmlichen Plattformen genommen, um die Flut von KI-Bewerbungen einzudämmen? Pech gehabt. HiringCafe crawlt mit ChatGPT Abertausende Jobanzeigen – auch von Firmenwebsites – und stellt sie somit wieder der ganzen Öffentlichkeit zur Verfügung. Auch in der Schweiz gibt es bereits Anbieter wie truast.ch, die KI-gestützte Komplettlösungen für den Bewerbungsprozess versprechen.
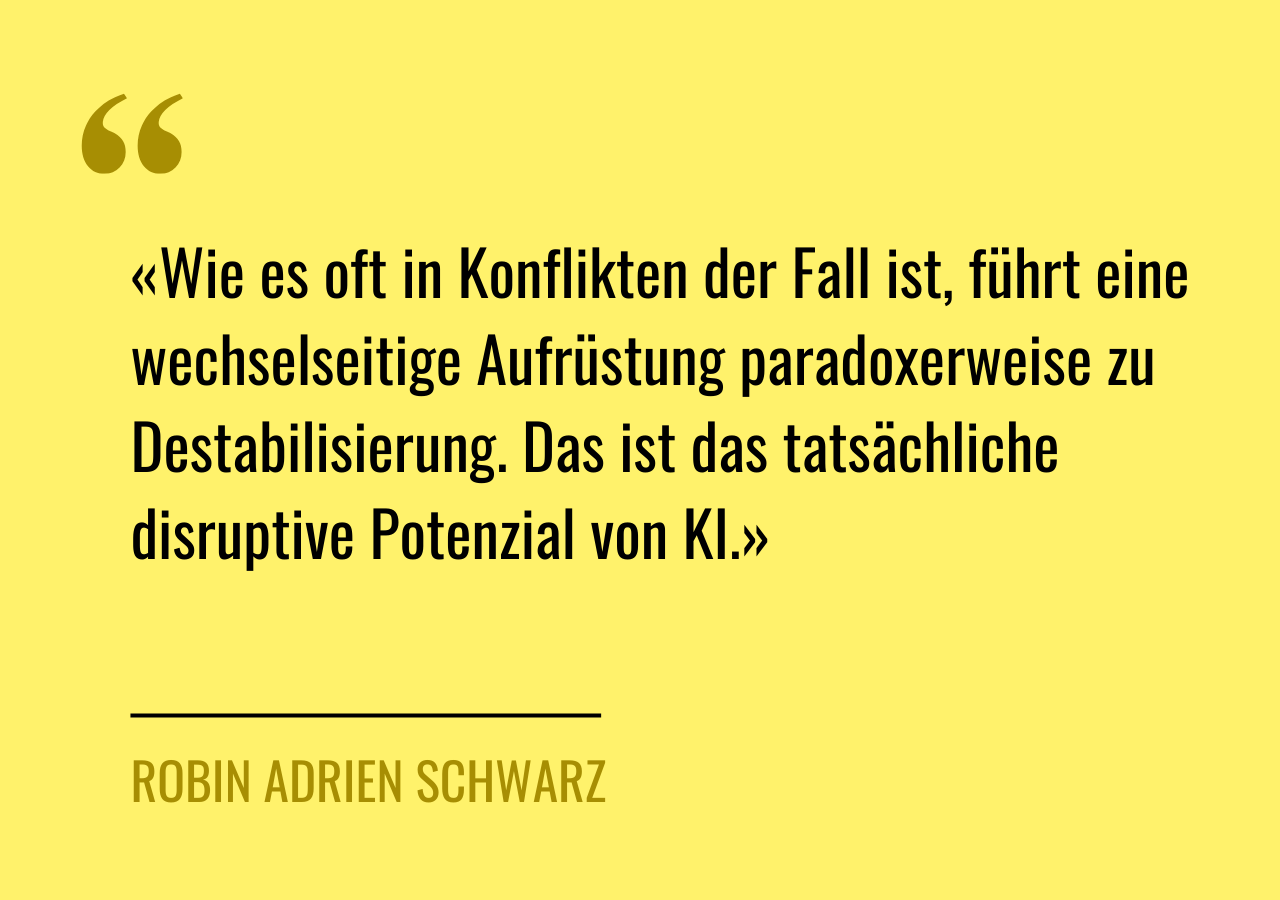
Vielleicht sagen Sie jetzt: Gut, immerhin haben wir KI-Detektoren, mit denen wir Bewerbungen und CVs aussortieren können. Die schlechte Nachricht: Die meisten KI-Detektoren sind wenig ausgereift, liefern falsch positive Ergebnisse und sortieren womöglich den perfekten Match aus. Geschichten, beispielsweise von Studierenden an Unis, deren Essays zu Unrecht als KI-generiert beurteilt wurden, gibt es bereits zuhauf. Und auch hier: Schreibt die KI zu gerade, zu perfekt, zu unmenschlich? Ja, das stimmt. Aber KI kann auch lernen, Imperfektionen in Texte einzubauen, um sie wieder authentisch wirken zu lassen. Denn Authentizität ist nicht einfach schlichte Echtheit, sondern das, was wir selbst unter Authentizität verstehen und gemeinsam verhandelt haben.
Selbst wenn die KI-Detektoren besser wären: Sie anzuwenden, spielt genau in jene Dynamik des Frusts und der Unzufriedenheit, die überhaupt erst dazu geführt hat, dass diese Tools eingesetzt werden. In diesem Sinne sind die Versuche, KI strikt vom Menschlichen zu trennen, zum Scheitern verurteilt, denn das Wettrüsten wird dadurch nicht abgewürgt, sondern weiter angetrieben.
Und genau wie es oft in Konflikten der Fall ist, führt eine wechselseitige Aufrüstung paradoxerweise zu Destabilisierung. Das ist das tatsächliche disruptive Potenzial von künstlicher Intelligenz.
Vertrauen hinter der Bezahlschranke?
Was nun im Fall von KI folgt, ist keine Kehrtwende, sondern eine Konsequenz systemischer Bedingungen. Der Unterschied zu vorherigen technologischen Errungenschaften: Die Dynamik hat einen eskalativen Charakter. Noch vor wenigen Jahren hielt man das, was heute mit KI möglich ist, für ein Zukunftsszenario.
Erst im Mai sagte die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, anlässlich der jährlichen Budgetkonferenz: «Wir dachten, dass künstliche Intelligenz erst etwa im Jahr 2050 an menschliches Denkvermögen heranreichen würde. Jetzt erwarten wir, dass das schon nächstes Jahr geschieht. Es ist schlichtweg unmöglich, heute vorherzusagen, wohin uns die Innovation bis zum Ende des nächsten Haushaltszyklus führen wird.»
Was von der Leyen hier anspricht: Die Entwicklungen rund um KI beschleunigen sich extrem schnell, in Benchmark-Tests jagt ein Rekord den nächsten und das, was gestern noch als Best Practice galt, war ebenfalls gestern schon überholt. Jetzige KI-Tools sind keine zukunftssicheren Lösungen, sondern nur die erste, schlecht ausgerüstete Kohorte. Das, was danach kommt: tatsächliche KI-Agenten, die Aufgaben autonom ausführen. Die Tools von jetzt werden bald lediglich wie interessante Spielereien wirken, ähnlich wie die ersten Apps auf den ersten Smartphones. Die natürlichen Anpassungszyklen bei Technologien sind über die Zeit immer kürzer geworden – am Beispiel von KI wird das eindrücklich ersichtlich. Die Innovation kommt in Kaskaden.
Dass auch KI-Skeptikerinnen und -Skeptiker in vielen Punkten Recht haben mögen und der KI-Hype schwer von der Realität separierbar ist, stimmt. Das heisst auch: Ja, die KI-Bubble ist eine Tatsache und wird noch Opfer fordern. Jedoch lag selbst der hochdekorierte Ökonom Paul Krugman 1998 komplett daneben, als er prophezeite, dass die rasante Entwicklung des Internets primär Hype sei: «Bis 2005 wird klar sein, dass das Internet nicht mehr Einfluss auf die Wirtschaft hatte als das Faxgerät.» Natürlich können sich immer noch beide Seiten irren.
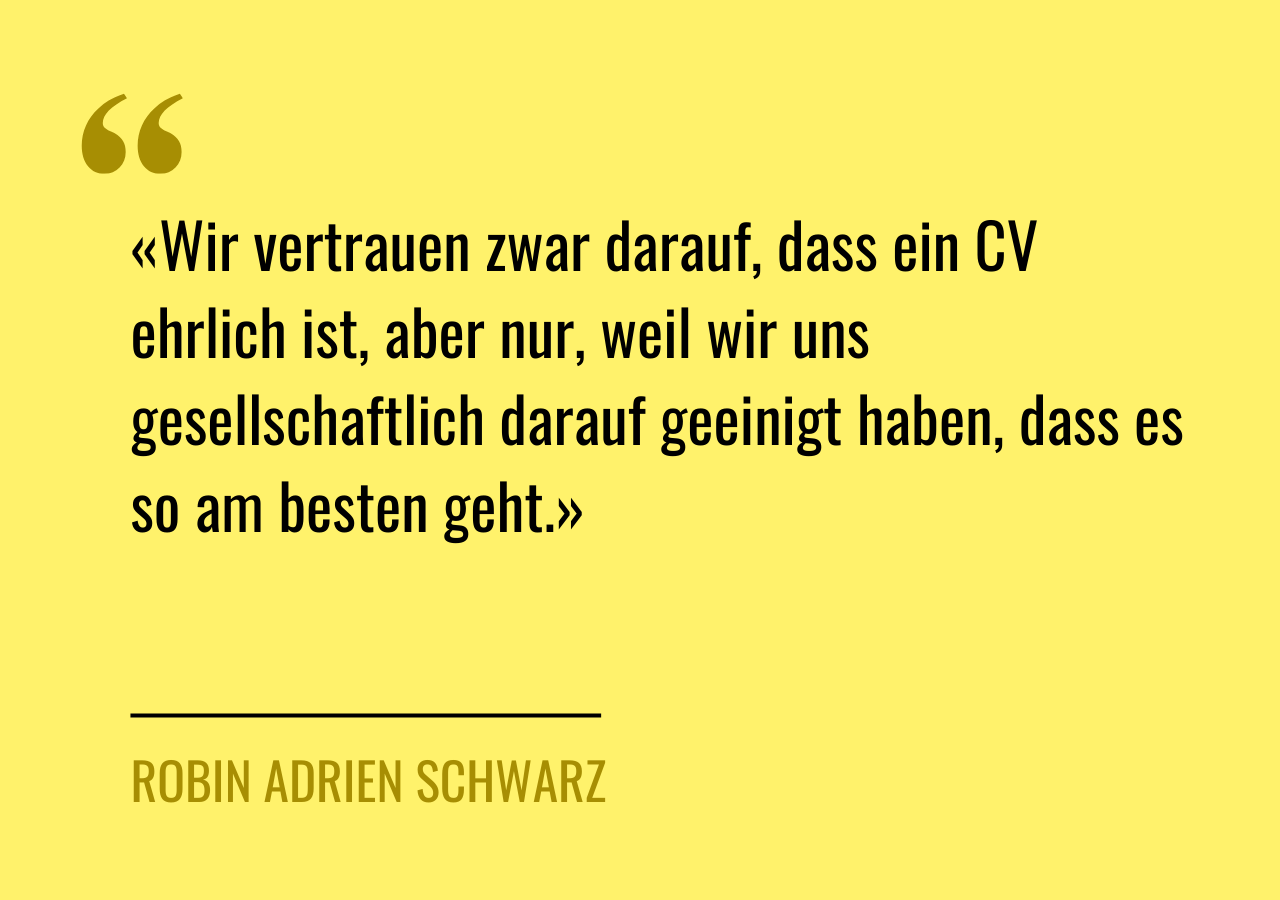
Tatsache ist, dass der Jobmarkt durch KI dabei ist, sich grundlegend zu verändern – und somit auch das Recruiting. Im Zentrum dieser Veränderung: der Vertrauensverlust. Das gegenseitige Vertrauen ist eine der grossen Ressourcen unserer Gesellschaften. Es ermöglicht Koordination und Kollaboration. Es wird also darauf vertraut, dass das Gegenüber den Gesellschaftsvertrag einhält, weil dieser für liberale Gesellschaften zwar fundamental, aber eben kein Naturgesetz ist. Sprich: Wir vertrauen zwar darauf, dass ein CV ehrlich ist, aber nur, weil wir uns gesellschaftlich darauf geeinigt haben, dass es so am besten geht. Doch Vertrauen als Ressource erodiert zunehmend – sichtbar beispielsweise an der viralen Verbreitung von Desinformation und Verschwörungstheorien – und als Währung des Liberalismus befindet sie sich mitten in der Inflation.
Wenn Sie nicht mehr unterscheiden können, welches der Hunderten von Bewerbungsschreiben von einer realen Person kommt, was dann? Wenn Sie nicht einmal mehr wissen, ob Sie im Video-Jobinterview tatsächlich mit einer echten Person sprechen und nicht mit einem AI-Papagei, was dann? Braucht es dann noch ein Tool und noch ein Tool und noch ein Tool? Gewinnen Sie dadurch jene Sicherheit zurück, die Sie verloren haben?
Der Triumphzug der KI ist nicht die Ursache für den Vertrauensverlust, sondern eine Konsequenz und ein Katalysator bereits existierender ökonomischer, materieller Bedingungen. Marktdynamik und Selbstregulation, auf die immer vertraut wurde, geraten aus den Fugen. Beschleunigt sich diese Dynamik weiter ohne Intervention, rutschen wir in eine Vermittlungskrise. Die Frage, die nun beantwortet werden muss: Wie können wir ein vertrauensvolles Fundament für das Recruiting und den Jobmarkt der Zukunft schaffen? Wohl nicht, indem wir das Vertrauen hinter eine Bezahlschranke setzen.



