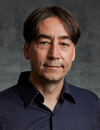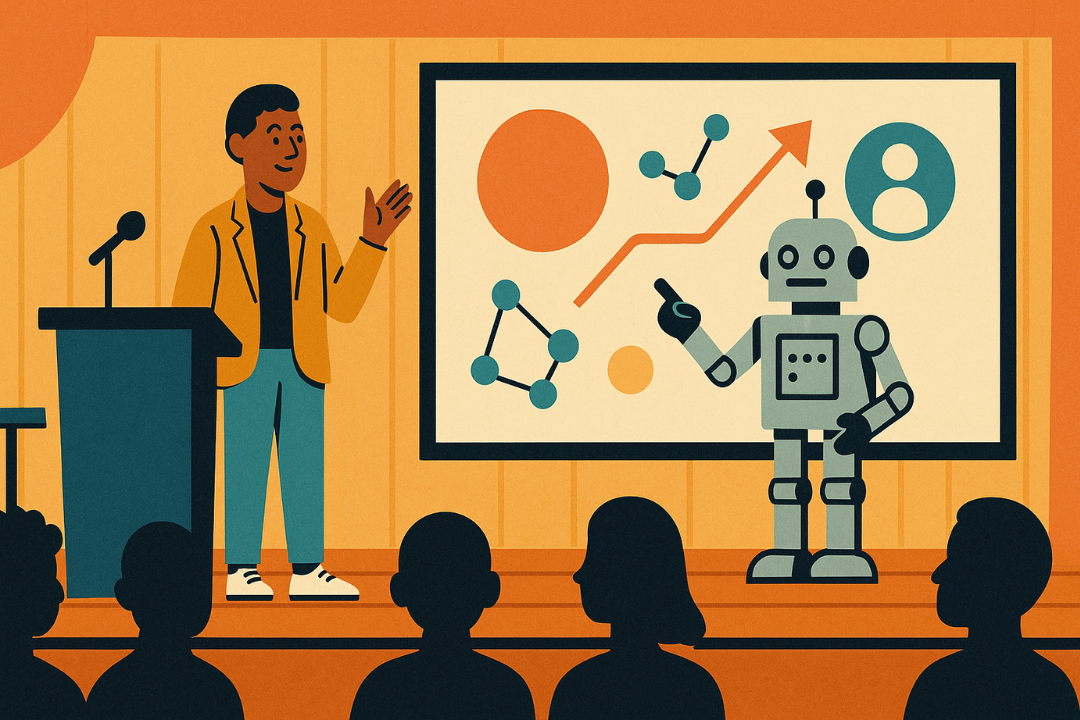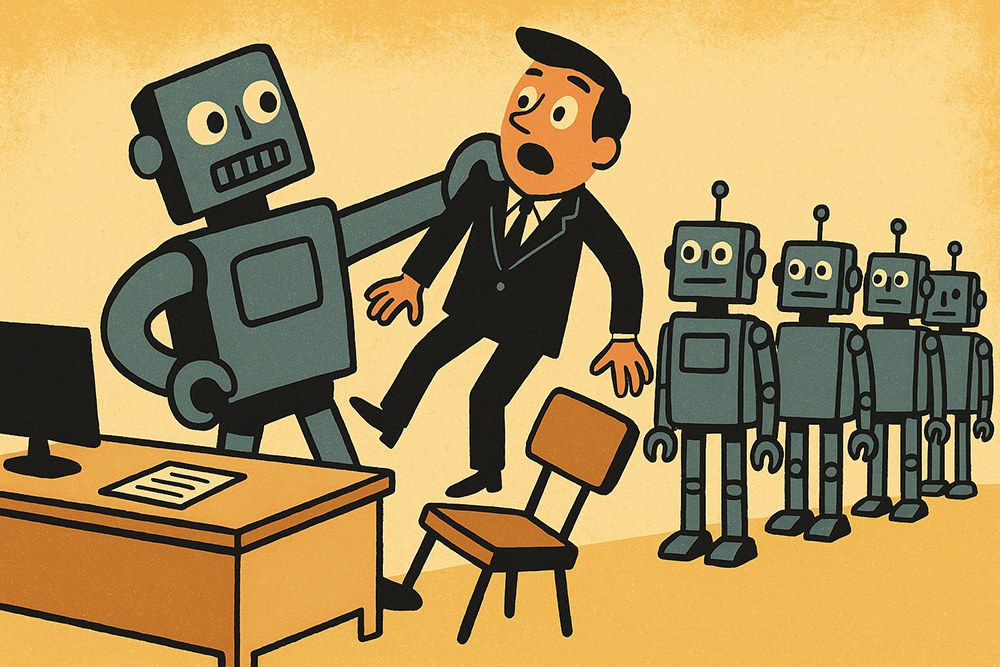«In der Romandie ist die Offenheit für Skills und Potenzial tendenziell grösser»
Karrierechancen in der Romandie werden oft über Sinn, Kultur und Wirkung vermittelt, während in der Deutschschweiz Stabilität und Strukturen im Vordergrund stehen. Für Headhunter Thomas Bossard von Stellar Executive Search bedeutet das: Erfolgreiches Recruiting über die Sprachregionen hinweg erfordert Übersetzungsarbeit zwischen den Denkwelten.
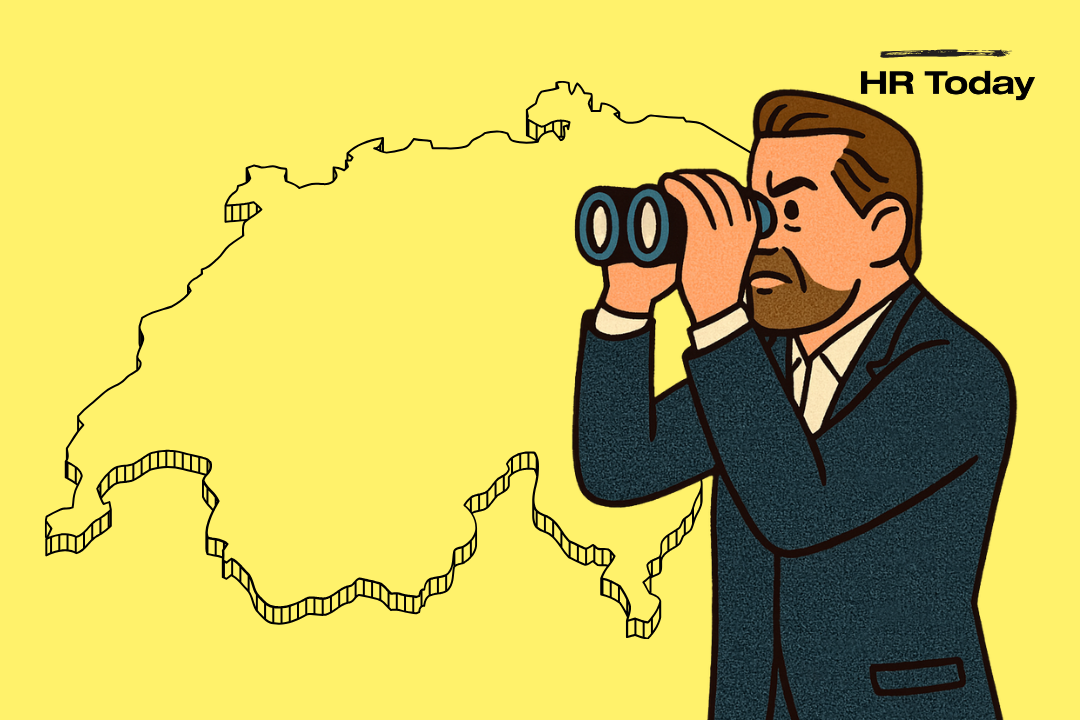
Die Unterschiede zwischen der Deutschschweiz und der Romandie sind gar nicht so gross. (Bild: ChatGPT)
HR Today: Herr Bossard, stellen Sie bitte kurz Stellar Executive Search vor.
Thomas Bossard: Gern. Stellar Executive Search ist schweizweit unterwegs, mit Standorten in Zürich, Bern, Lausanne und Genf. Wir sind Headhunter und auf Schlüsselpositionen in fünf Sektoren spezialisiert: Finanzdienstleistungen, Industrie, Konsumgüter, Bau und Immobilien sowie ICT. Diese Ausrichtung ergab sich aus den Profilen unserer Partner: Beispielsweise gibt es in Lausanne sehr grosse Ingenieurbüros – die dortigen Partner brachten die entsprechende Expertise mit. Grundsätzlich ist Stellar ein Zusammenschluss von langjährigen Partnern aus zwei Headhunter-Unternehmen. Wir sind somit kein klassisches Start-up, sondern haben unsere Karrieren unter einem Dach zusammengeführt. Der grosse Unterschied zu unseren Mitbewerbern ist, dass wir uns von Beginn an gesamtschweizerisch ausgerichtet haben: Stellar besteht aus gleichberechtigten Partnerschaften über die Regionen hinweg.
Was sind die Vorteile dieser Partnerschaften?
Das ermöglicht uns einen anderen Dialog, sowohl unter den Partnern als auch mit den Kunden. Wir sind eben nicht einfach eine Zürcher Firma mit Westschweizer Ableger, sondern eine gesamtschweizerische Firma mit lokal integrierten Teams. Das macht uns für Kunden nahbar und authentisch. In Lausanne liegt der Fokus auf Bau- und Infrastruktur-Ingenieurinnen und -Ingenieuren sowie Retail und Luxusindustrie, in Genf auf Wealth Management und Private Banking, in Zürich auf dem Finanzbereich und in Bern insbesondere auf HR und ICT. Unsere Philosophie ist, so nah wie möglich am Markt zu sein, mit lokalem Netzwerk und regionalem Wissen. Das prägt unsere Arbeit. Unser Market-Mapping in Kombination mit direkter, sektornaher Ansprache garantiert einen schnellen, zielgerichteten Zugang zu Fach- und Führungskräften. Die diskrete Direktansprache ist integraler Bestandteil davon: Sie schafft Vertrauen und öffnet Türen, die über LinkedIn allein verschlossen blieben. Ich selbst bewege mich seit 14 Jahren als Headhunter im Finanzbereich und war vorher in Banken und bei Asset Managern tätig. Dadurch profitiere ich von der Bekanntheit meines Namens und einem Image, das dafür sorgt, dass man mir zuhört.
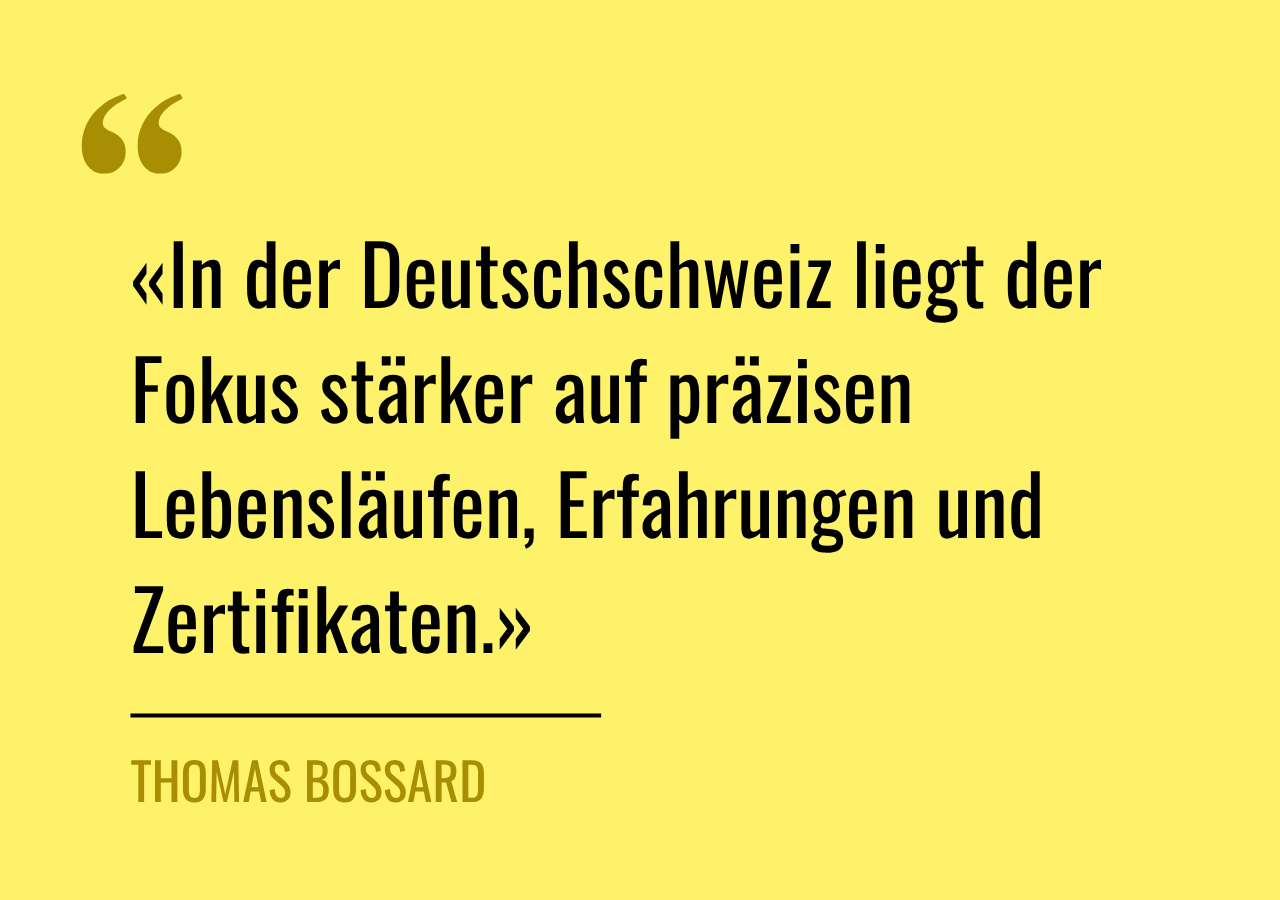
Für welche Rollen braucht es einen Headhunter besonders?
Wir besetzen vor allem Positionen in der Geschäftsleitung, Führungsfunktionen und die nächste Stufe darunter sowie Spezialistenprofile. Etwa jedes dritte Mandat ist sensitiv, beispielsweise bei Nachfolgefragen oder als Plan-B-Szenario – hochvertraulich und diskret. Dafür braucht es Marktzugang, Marktintelligenz und einen Vertrauensbonus, der aus vielen Jahren im Markt gewachsen ist.
Manche sagen: «Man findet heute eh alle auf LinkedIn.» Sehen Sie das auch so?
Nein, bei Weitem nicht. Wir investieren sehr viel ins Research. Ein Beispiel: Eine Kundenberaterin, die deutsche HNW-Kunden betreut, ist oft gar nicht oder nicht mit der genauen Funktion auf LinkedIn. Da steht vielleicht einfach «Kundenberaterin». Aber das reicht nicht. Gerade im Private Banking dauert es oft Jahre, bis sich ein Relationship Manager für einen Wechsel entscheidet. Das ist nicht wie eine Ingenieurin, die einfach von A nach B wechselt. Ein Kundenberater wechselt mit einem Kundenportfolio, und das Vertrauen der Kunden ist sein Kapital. Das sind sehr intensive Prozesse. Darum: LinkedIn ist eine Quelle, aber es ersetzt nicht unsere Netzwerke, die wir über viele Jahre aufgebaut und gepflegt haben. Insbesondere schwer auffindbare Schlüsselkandidatinnen und -kandidaten müssen anderweitig durch gezielte Recherche identifiziert werden, hier kommt unsere langjähre Erfahrung zum Tragen.
Vermittelt Stellar vor allem Einzelpersonen?
Einzelpersonen, aber auch häufig Teams. Gerade bei grossen Team-Moves braucht es einen Headhunter, der den Gesamtprozess orchestriert – quasi Plug-and-Play von einem Unternehmen zum anderen. Im Asset Management sind es manchmal ganze Investment-Teams, im Private Banking oft Relationship-Manager-Teams, die seit 20 Jahren Kunden betreuen und sich nur gemeinsam bewegen. Das sind nochmals ganz andere Konstellationen als eine Einzelbesetzung.
Wie viel ist Direktansprache – und wie viele Kandidatinnen und Kandidaten kommen proaktiv zu Ihnen?
Unser Fokus liegt klar auf der Direktansprache – sicher bei 80 Prozent. Wenn wir ein Mandat übernehmen, erstellen wir ein Market-Mapping und gehen gezielt auf die Zielkandidatinnen und -kandidaten zu. Natürlich kommen auch immer wieder Leute auf uns zu, im Sinne: «Ich wäre offen für den nächsten Schritt». Beides ist wichtig, und wir bekommen kontinuierlich viele Empfehlungen, weil wir laufend spannende Positionen exklusiv begleiten.
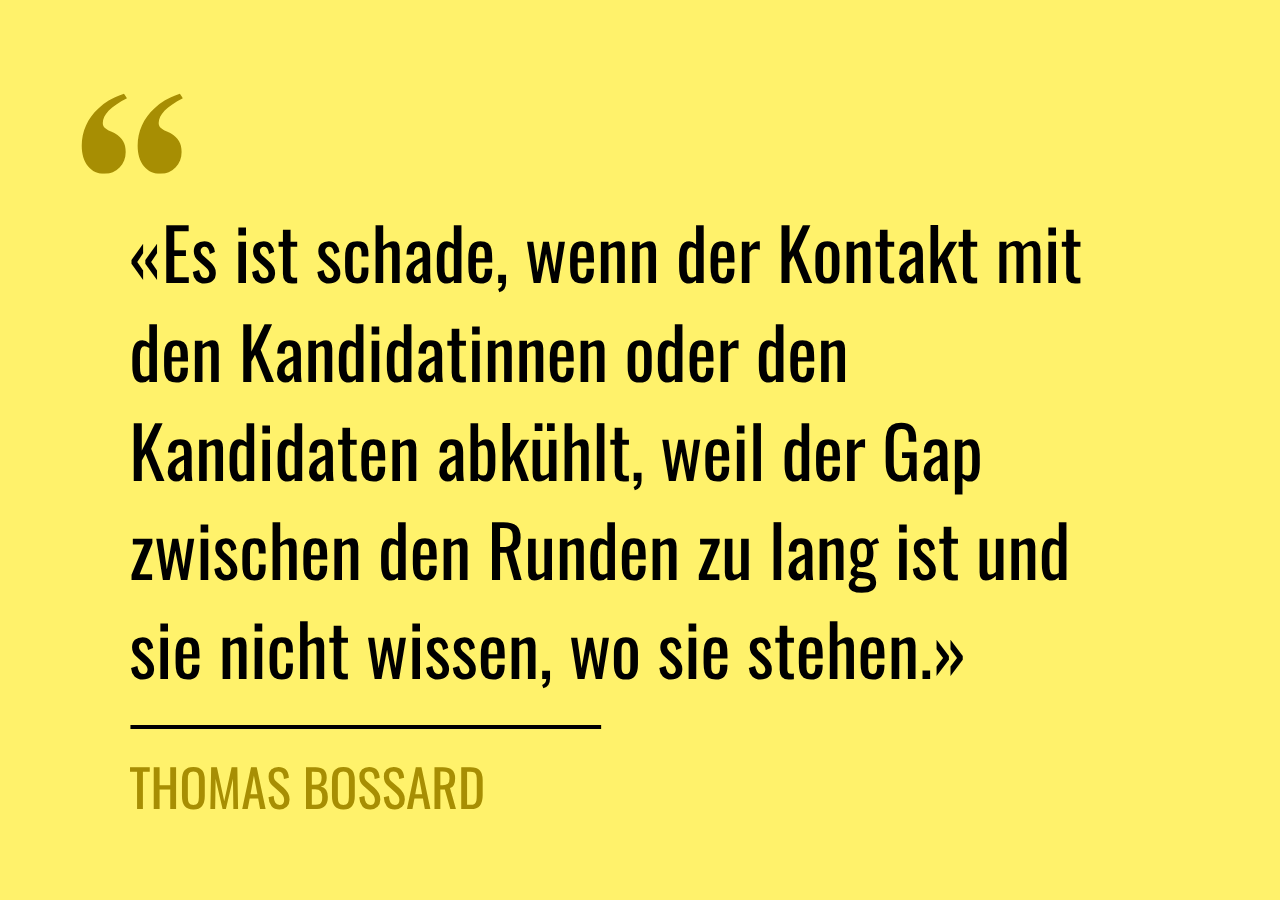
Wie läuft die Direktansprache ab?
Ich überlege mir vorgängig, was bei Zielkandidatinnen und -kandidaten der Trigger sein könnte: mehr Verantwortung, mehr Wirkung oder ein Aufstieg von der «Nummer 2» zur «Nummer 1»? Dann folgt klassisch ein Short Call: Wenn wir uns nicht kennen, halte ich mich wirklich kurz; wenn wir uns kennen, rufe ich direkt aufs Mobile an. Ich stelle sehr transparent dar, worum es geht: Entwicklung, Gestaltung, Wirkung. Das Salär kommt erst danach. Und wenn der Kontakt vielversprechend ist, führe ich mit der Kandidatin oder dem Kandidaten ein persönliches Gespräch respektive ein strukturiertes Interview von mindestens einer Stunde. Danach bereite ich die Entscheidungsträgerinnen und -träger der Firma auf das Treffen mit der Kandidatin oder dem Kandidaten vor und begleite den gesamten Rekrutierungsprozess. Ein Tipp für alle Recruiterinnen, Recruiter und Linienverantwortlichen: Wichtig ist, dass dieser Prozess kompakt und transparent bleibt. Es ist schade, wenn der Kontakt mit den Kandidatinnen oder den Kandidaten abkühlt, weil der Gap zwischen den Runden zu lang ist und sie nicht wissen, wo sie stehen.
Wie gehen Sie dabei vor?
Ich schlage nicht heute den ersten, in drei Wochen den zweiten und in sechs Wochen weitere Kandidatinnen und Kandidaten vor, sondern liefere kompakt, damit die Vergleichbarkeit von Anfang an da ist. Danach filtere ich idealerweise auf drei finale Kandidatinnen oder Kandidaten – danach entscheidet das Unternehmen. Zu meinen Aufgaben gehört es, den Dialog auf beiden Seiten lebendig und vertrauensvoll zu halten, damit der Kontakt nicht – wie bei Direktbewerbungen oft der Fall – plötzlich abbricht. Gleiches gilt fürs Employer Branding: Der erste Kontakt zur Firma läuft über uns – und den müssen wir als Repräsentanten «heiss» halten. In der finalen Phase führen wir oft auch die Verhandlung zu Themen wie Lohn oder Vertragsdetails zusammen. Wir sind schlicht näher an beiden Seiten dran, als wenn alles direkt zwischen den Parteien läuft.
Was passiert, wenn im Prozess Missverständnisse oder Unsicherheiten auftauchen?
Dann greifen wir ein. Wir stärken Kandidatinnen und Kandidaten nach, klären offene Fragen und überbringen Botschaften. Wir verstehen uns als Vermittler – gerade in der finalen Phase, wenn es um Budgets oder Erwartungshaltungen geht.
Woran scheitern Rekrutierungen aus Ihrer Sicht am häufigsten?
An der fehlenden Konsistenz: Viele Kandidatinnen und Kandidaten suchen Sinn, Wirkung und Potenzial – und das muss konsistent dargestellt werden und erlebbar sein. Wenn der eine etwas so beschreibt und der andere anders, entsteht Unsicherheit – und die Kandidatinnen und Kandidaten ziehen sich zurück. Partnerschaftlich arbeiten, transparent bleiben, positives Momentum halten: Wir begleiten und stärken Kandidatinnen und Kandidaten durch den gesamten Prozess. So entstehen erfolgreiche Rekrutierungen.
Wie beurteilen Sie den Einfluss von künstlicher Intelligenz (KI) im Recruiting?
KI ist eine Chance, vor allem für Effizienz in frühen Phasen: Sourcing, Market-Mapping, Screening – auch mit unseren eigenen Datenbanken. Aber sie hat Grenzen: Cultural-Fit-Beurteilung, Vertragsverhandlungen, Konfliktmanagement – das setzt emotionale Intelligenz, Erfahrung und Einfühlungsvermögen voraus. Spannend finde ich Ideen wie den Einsatz von KI für Assessment-Trainings oder die Interview-Vorbereitung; Das kann dabei helfen, die Gespräche inhaltlich effizienter zu gestalten und Kandidatinnen und Kandidaten besser vorzubereiten. Am wertvollsten ist die Kombination: KI liefert Daten, wir liefern Dialog.
Viele sehen die Zukunft im skillsbasierten Recruiting. Wie stark löst sich Stellar vom klassischen Lebenslau?
Wir verbringen bei unseren eigens entwickelten strukturierten Interviews viel Zeit mit den Kandidatinnen und Kandidaten und fokussieren uns stark auf Skills, Potenzial und Passfähigkeit. Unsere Auftraggeber erhalten Empfehlungen, die weit über den CV hinausgehen. Der Lebenslauf ist zwar ein Teil des Prozesses, aber unsere Einschätzung hat oft die grössere Wirkung. Beides hat seine Berechtigung. Unsere Aufgabe ist es, kulturelle Unterschiede zu «neutralisieren» und im Sinne des besten Matches zu vermitteln.
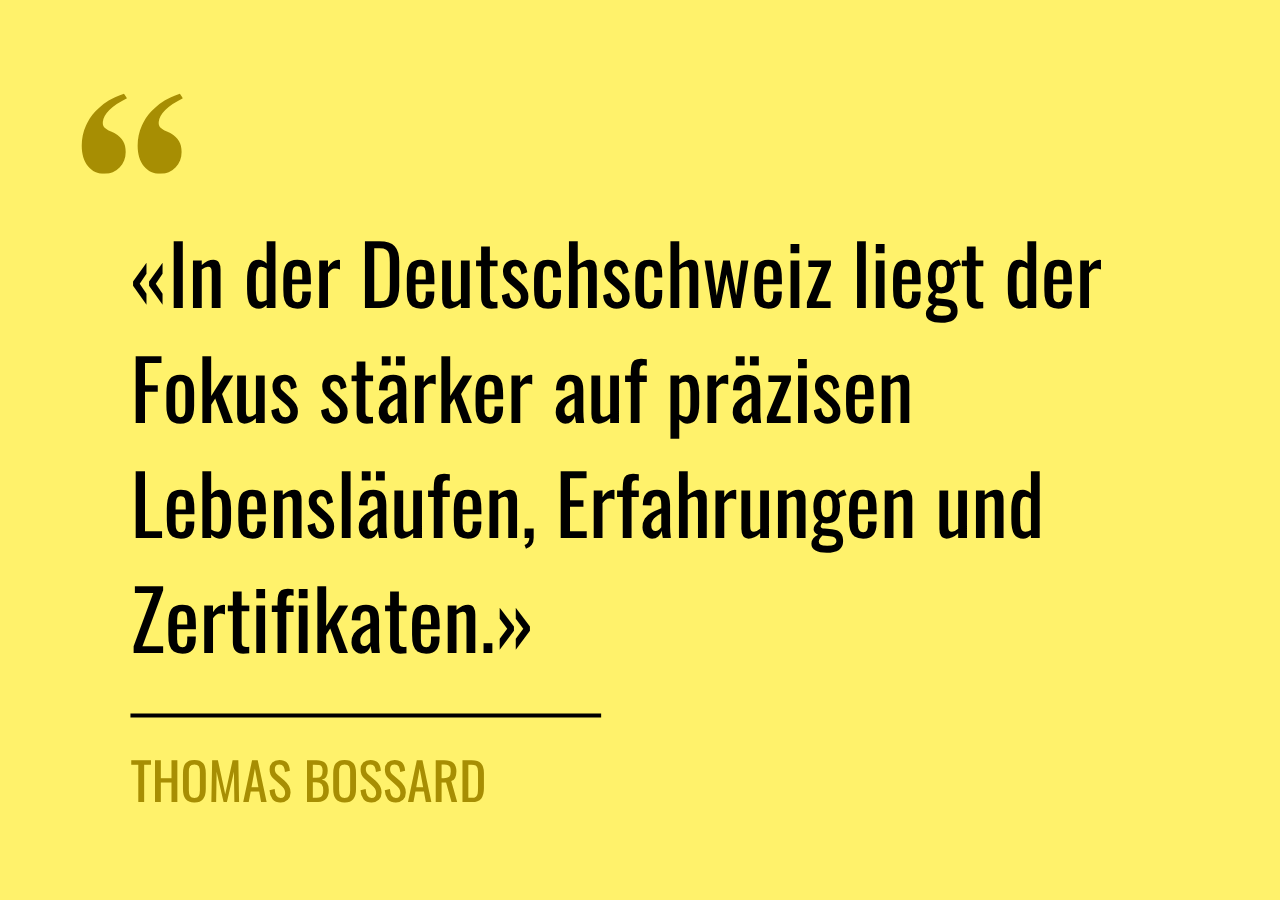
Welche Unterschiede erleben Sie diesbezüglich zwischen der Romandie und der Deutschschweiz?
Es zeigen sich durchaus regionale Unterschiede: In der Romandie ist die Offenheit für Skills und Potenzial tendenziell grösser – dort wollen Kandidatinnen und Kandidaten wissen, wie sie sich entwickeln können. In der Deutschschweiz liegt der Fokus stärker auf präzisen Lebensläufen, Erfahrungen und Zertifikaten. Auch beim Employer Branding wirken in der Westschweiz Botschaften stärker über Sinn, Zweck, Kultur und Lifestyle – der Job wird Teil der persönlichen Identität. In der Deutschschweiz zählen hingegen Reputation, Stabilität und Solidität stärker – also für welche Firma man arbeitet und wie verlässlich sie ist.
Und in der Zusammenarbeit, der Kommunikation und den Entscheidungswegen?
Entscheidungen sind in der Westschweiz häufig partizipativer und persönlicher; in der Deutschschweiz strukturierter und dokumentierter. Kommunikation ist unterschiedlich gefärbt; wichtig ist, dass wir als «Brückenbauer» die Botschaften jeweils adaptieren. Beispiel: Wenn wir für einen Zürcher Auftraggeber in der Romandie rekrutieren, übersetzen wir Erwartungshaltungen und Positionierung in die lokale Marktsprache – und umgekehrt für einen Genfer Auftraggeber in Zürich. Oft arbeiten zwei Partner auf einem Mandat, auch sprachübergreifend; das lokale Markt-Know-how in Genf oder Zürich ist dann entscheidend.
Wie steht es um die Mobilität der Kandidatinnen und Kandidaten zwischen der Deutschschweiz und der Romandie?
Mandate setzen wir meist im lokalen Netzwerk um, aber wir klären die Mobilität immer. In der Romandie stossen wir häufiger auf Fachkräfte aus Frankreich; in der Deutschschweiz öfter auf solche aus Deutschland. Die Grenzgänger-Thematik ist in der Romandie etwas ausgeprägter – das hat man ja in der Covid-Zeit besonders in den Spitälern gesehen. International rekrutieren wir gezielt für spezifische Expertisen, beispielsweise in Grossbritannien. In Zürich gibt es Banken mit sehr internationalem Mitarbeiterbestand, teils über 30 Nationalitäten und rund 20 Prozent Deutsche. Wichtig bleibt jedoch immer die Achse Schweiz.

Sie haben gesagt, Sie «übersetzen» Erwartungen zwischen den Sprachregionen. Können Sie das ausführen?
Gerade im Bereich der weichen Faktoren kann der Headhunter den Unterschied machen. Wir bieten weit mehr als ein klassisches Stellenprofil, indem wir erklären, wie die Firma unterwegs ist, was ihre Ziele sind, wie der Job im Setup wirkt. In der Deutschschweiz gehe ich stärker auf Wachstum, Strategie, Strukturen ein. In der Romandie ist mehr die Wirkung der Person im Team, der Impact im Vordergrund. Diese Unterschiede übersetzen wir. Man darf nicht vergessen: Die Kandidatinnen und Kandidaten, die wir ansprechen, befinden sich meist in ihrer Komfortzone. Sie haben gute Jobs, bringen Leistung. Wenn ich sie gewinnen will, muss ich echten Mehrwert bieten, damit sie mir ihre Zeit und ihr Vertrauen schenken. Dabei hilft unsere Branchenexpertise: Ich kann ein Unternehmen sehr detailliert darstellen, kenne die Strukturen, Modelle, Erwartungen und kann so Vertrauen schaffen.
Wie lange bleiben die Vermittelten heute in ihren Positionen? Gibt es auch da Unterschiede?
Der Turnover ist generell kürzer geworden. Früher blieb man zehn oder zwanzig Jahre im gleichen Job – heute sind die Zyklen deutlich kürzer. Aber Unterschiede gibt es: In der Deutschschweiz ist man nüchterner, analysiert Strukturen, entscheidet vorsichtiger. In der Romandie gibt man schneller Chancen, ist offener für neue Schritte.
Ihr Fazit zum Thema Westschweiz und Deutschschweiz?
Die Unterschiede zwischen der Romandie und der Deutschschweiz sind real, aber nicht so gross, wie oft behauptet wird. Oft sind die Unterschiede zwischen Branchen grösser als zwischen Regionen. Entscheidend ist, die Nuancen zu kennen und ernst zu nehmen. Am Ende zählen nicht die Unterschiede, sondern die Brücken. Wir bei Stellar verstehen uns deshalb als Brückenbauer: Wir verbinden Menschen, Märkte, Kulturen, Vertrauen und Strukturen – wenn alles zusammenkommt, entstehen die besten Ergebnisse.