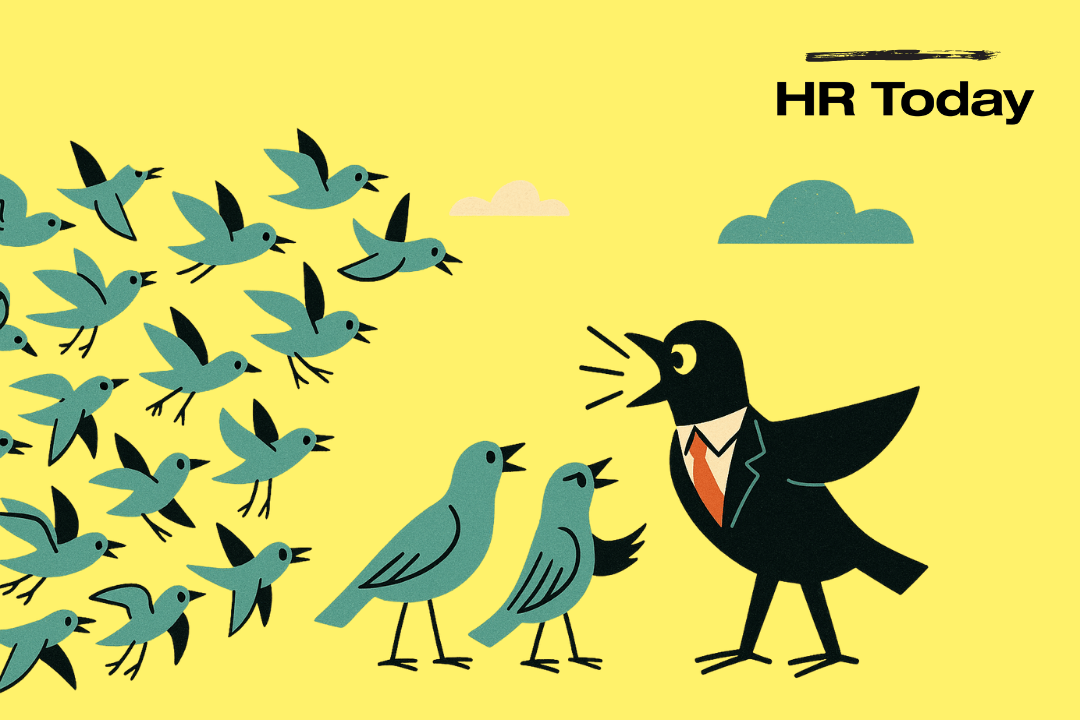«Zuhören heisst nicht, ich gebe dir recht, aber ich nehme dich ernst»
Diversity – ein Wort, das Emotionen weckt. Manche verwenden es als leeres Buzzword, manche mit Spott, manche mit Wut. Und nur wenige mit Bedacht. So jemand ist Yuvviki Dioh. Sie ist Diversitätsagentin am Schauspielhaus Zürich. Ein Gespräch über Frust und Wut, Schönheit und Freude, Brücken und Klüfte.

An Diversität kann man nur gemeinsam bauen. (Bild: Aniela Schafroth)
Am Schauspielhaus Zürich ist gerade die letzte Woche dieser Spielzeit angebrochen, die letzten Vorstellungen stehen an und die Sommerferien vor der Tür. Es ist still. Die Sonne brennt und die Hitze flimmert durch die leeren Hallen des Schiffbaus, dabei ist es erst Vormittag. «Ein spezieller Zeitpunkt», sagt Yuvviki Dioh. Etwas müde sei sie. «Wir sind eigentlich schon einen Monat dabei, uns voneinander zu verabschieden.» Nicht nur dieser Monat, sondern überhaupt die letzte Zeit, ging an die Substanz. Nicht nur ihr. Und doch spricht sie hell, wach, klar, gestikuliert energisch, mehr mit ihren Fingern als mit ihren Händen.
Nachdem die Verträge der beiden Intendanten Nicolas Stemann und Benjamin von Blomberg für die Saison 24/25 überraschend nicht verlängert wurden – das mediale Theater um das Schauspielhaus war gross – endet nun die Interimszeit von Ulrich Khuon. Bald wird Yuvviki Dioh also mit drei Intendanzen zusammengearbeitet haben, und das, obwohl sie erst seit 2022 am Schauspielhaus Zürich engagiert ist. «In den drei Jahren, seit ich hier bin, habe ich noch keine normale Spielzeit erlebt», sagt sie.
Eine herausfordende Zeit sei es gerade, sagt Dioh, und gleichzeitig sei man schon ein Jahr dabei, sich darauf vorzubereiten. «Eine Doppelbelastung.» Ein altes System finde nun seinen Abschluss und zeitgleich gestalte man ein neues bereits mit. «Man lebt in einer Doppelwelt».
Vom Wandeln zwischen den Welten
Mit dem Wandeln zwischen zwei Welten kennt sich Dioh aus, aufgewachsen in einer weissen Pflegefamilie mit weissen Pflegegeschwistern in Schwamendingen – einem klassischen Zürcher Working-Class-Quartier, das im kulturellen Gedächtnis als Symbol für den Schmelztiegel Schweiz steht. Während der weltweiten «Black Lives Matter»-Proteste hat sie sich dafür entschieden, sich verstärkt im antirassistischen Aktivismus zu engagieren. Nun bewegt sich Dioh, Kommunikationswissenschaftlerin mit Doktortitel, in den Kreisen der Schweizer Kulturelite, ihre Stimme gefragt, ihr Name in wichtigen Feuilletons anzutreffen – bis nach Deutschland.
Die Rolle, die sie am Schauspielhaus Zürich spielt, spiegelt genau dieses Wandeln zwischen den Welten wieder: Yuvviki Dioh, 33, ist Diversitätsagentin – die erste der Schweiz im Theaterkontext, wie in manchen Medien zu lesen war. Als solche soll sie auf allen nur erdenklichen Ebenen für Vielfalt sorgen, oder eher: Das Schauspielhaus dazu befähigen, herauszufinden und zu verhandeln, was Vielfalt überhaupt bedeutet, was sie ausmacht, aber auch, was Diversität nicht ist.
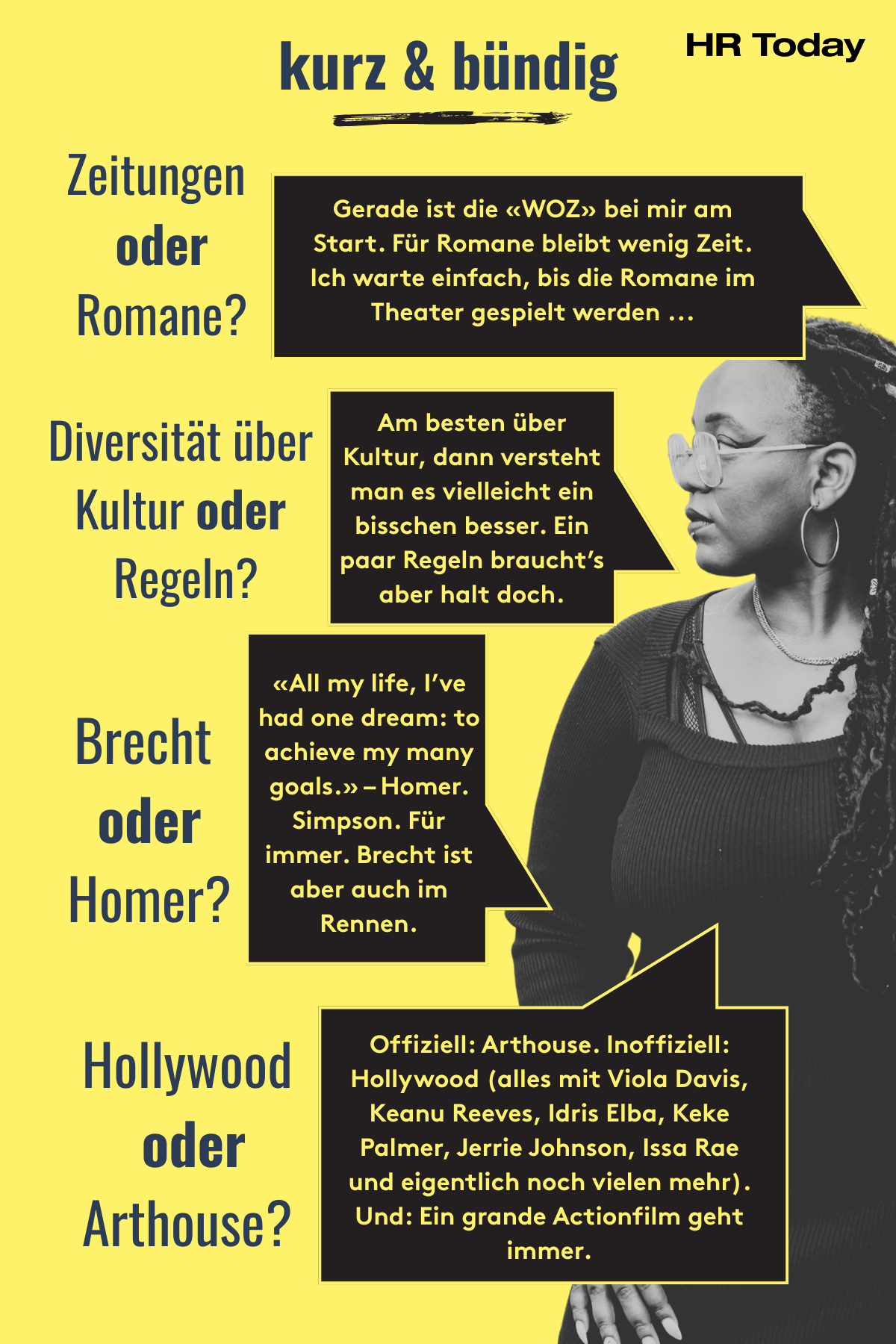
Das – und überhaupt der künstlerische und politische Kurs unter den letzten Co-Intendanten – gefällt nicht allen. Die NZZ bezeichnete das Schauspielhaus Zürich als «House of Wokeness» und fragte beispielsweise, ob man mit Steuergeldern «ein sektiererisches Gesellschaftsexperiment» finanziere, ob das, was am Theater passiere «woker Wahnsinn» sei. In dieser medialen Debatte fiel auch Yuvviki Diohs Name mehrfach. Dass Dioh aber auch nach der Intendanz von Stemann und von Blomberg weiterbeschäftigt wurde und wird – obwohl ihre Position organisatorisch an die Intendanz geknüpft ist – gibt der Wichtigkeit ihrer Arbeit Recht.
Diohs Arbeit hat wenig mit Corporate-Diversitätsklischees zu tun, wenig mit Quoten oder PR-Bildern, die möglichst «divers» sein müssen. Im Kern ihrer Arbeit steckt die Erkenntnis, dass Menschen unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben – und damit, so vielen Menschen wie möglich genau diese Erkenntnis – und ihre Konsequenzen – zu vermitteln. Aber auf eine Art, in der Unterschiede nicht als trennend wahrgenommen werden, sondern als Chance zur Verbindung. Eine Brücke baut nur, wer verstanden hat, dass es überhaupt eine Kluft gibt, die sich gemeinsam zu überwinden lohnt.
Ein Alltag mit BHs, Dramaturgie und Namen in Unterhosen
Vor allem aber hat Yuvviki Diohs Arbeit mit der alltäglichen Lebensrealität von Menschen zu tun. Einfach zusammenfassen lässt sich das aber trotzdem – oder gerade deswegen – nicht. Diversitätsarbeit bedeutet nicht nur Strategie und Employer Branding, sondern ein Achten auf Details und eine flexible Perspektive.
«Es beginnt alles bei der Frage, wie verschiedene Lebensrealitäten bei uns vorkommen und an der Institution teilhaben können, sei es als Mitarbeitende, Publikum, kunstschaffende Personen – oder in einer Funktion, die bislang nicht wirklich aktiv wahrgenommen wurde», sagt Dioh. «Meine Kernaufgabe ist, zu überlegen, wie wir sämtliche, vielleicht festgefahrenen Prozesse durchleuchten und transformieren können, damit so viele Bedürfnisse wie möglich abgedeckt werden.»
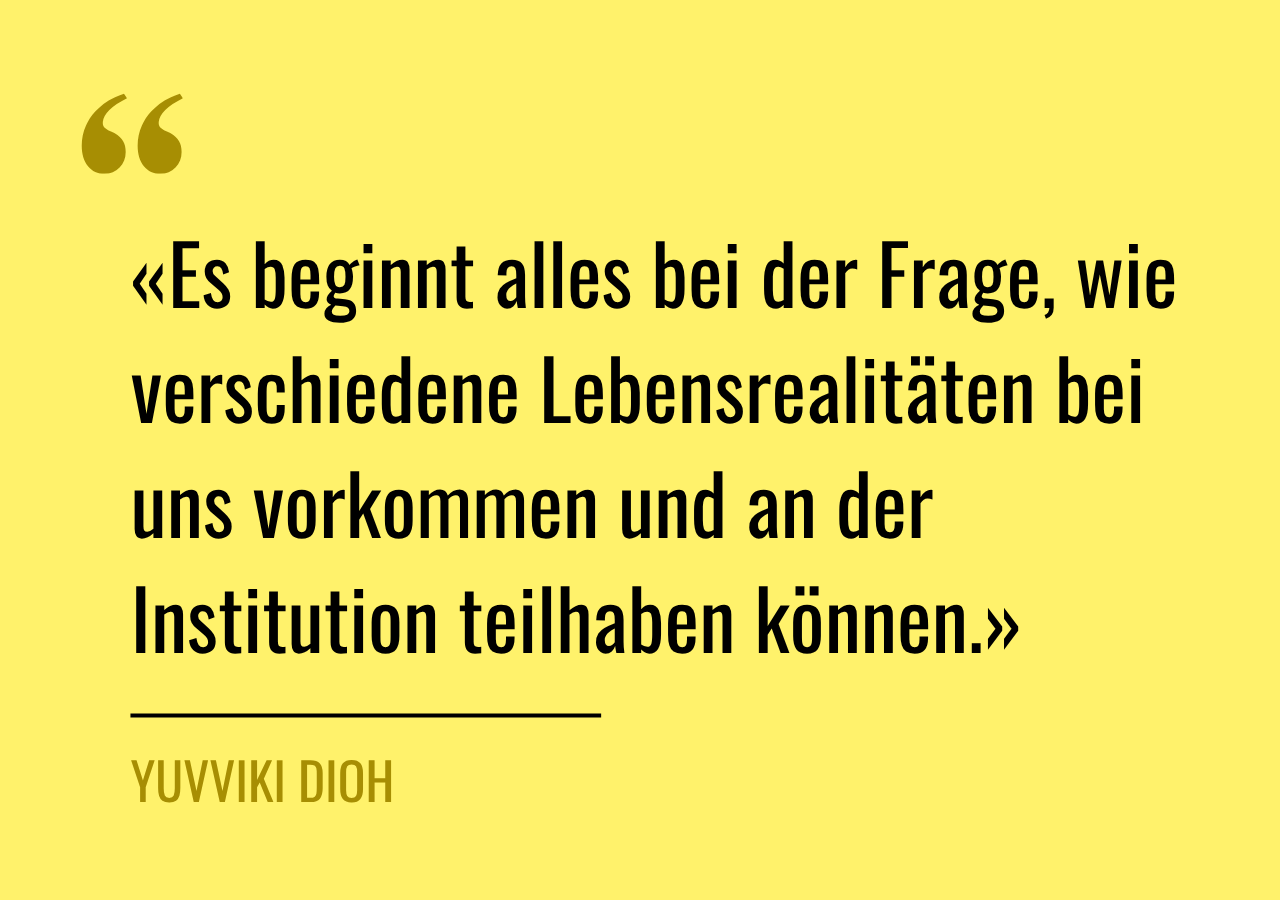
Einerseits arbeitet Dioh mit Dramaturgie und Regie zusammen, um die Inszenierungen so zugänglich und vielfältig wie möglich zu machen. Dabei stellt sie sich Fragen, wie etwa das Sounddesign für hörbehinderte Menschen physisch erfahrbar gemacht werden kann, oder wie neurodivergente Menschen bei sensorischer Überreizung jederzeit das Theater verlassen können. Noch konkreter wird es, wenn es etwa um Kostüme geht – von BH-Grössen bis zu den Namen, die in die Kostüme der Bühnenbesetzung eingenäht werden. Kleinigkeiten, möchte man denken – bis man versteht, was sie auslösen können: Beim Outing einer Person als non-binär wurde die Frage nach dem Umgang mit Namen plötzlich relevant. Aber nicht nur das: Kostüme und Personen sollen auf der Bühne lesbar sein, aber weder die Rollen, noch die Identitäten oder Körper der Besetzung kompromittieren. In diesem Fall ist Diversität tatsächlich der Stoff, aus dem das Theater gemacht wird. Sprich: Aus den offenbar kleinsten Details ergeben sich plötzlich viele Folgefragen.
Die Bandbreite von Diohs Arbeit wird noch klarer, weil sie auch mit ganz anderen Fragen zu tun hat: Wie machen wir Premierenpartys für alle Menschen angenehm? Zum Beispiel mit Rückzugsorten oder Ohrstöpseln gegen den Lärm? Intern sei eine Person von dieser Frage irritiert gewesen – habe dann aber begeistert festgestellt, dass das sogar ihr etwas bringt – und allen.

Hinter dieser Erkenntnis steckt einer der zentralen Ansätze von Yuvviki Dioh: Universal Design Thinking, sprich: Nicht einfach für exklusive Partikulargruppen denken, sondern, dass Bedürfnisse so umgesetzt werden, dass sie am Ende allen nützen. Eine Rampe hilft nicht nur der Person mit dem Rollstuhl. Sie hilft auch einer Person mit Kinderwagen oder, wenn mensch einen schweren Koffer transportieren muss», erklärt Dioh.
«Wir müssen dem Theater Sorge tragen», meint Dioh, «Theater vermittelt und produziert gleichzeitig Wissen. Wir wollen einen Ort schaffen, wo wir das, was in unserer Welt passiert, verhandeln und zwischen Gruppen vermitteln können. Einen Ort, wo wir Menschen andere Lebensrealitäten näherbringen können. Aber auch einen Ort, wo wir durch die Wissensvermittlung den Dialog fördern können. Und zwar auf Augenhöhe.» Und damit meint sie den richtigen, nicht rein rhetorischen Dialog – zu oft behaupte man, man wolle «mit Anderen reden». «Aber wir wissen alle, dass das nicht passiert.»
Zuerst der Mensch, dann der Rest
Ein Grossteil von Diohs Arbeit sei darum Sensibilisierungsarbeit. Das heisst: mit Leuten reden. Viel. Oft. Denn im Theater als Schnittstellenfunktion, als Ort der Wissensvermittlung und - produktion gibt es wenig einfache und schon gar keine finalen Antworten. «Ich versuche den Menschen Wissen zu vermitteln, ja, aber gleichzeitig auch das Wissen darum, dass dieses Wissen nicht fix ist». «Auch mir fehlen gewisse Begriffe oder ich merke, der Begriff trifft nicht das, was ich eigentlich sagen will, aber wir haben gerade nichts anderes. Ich weiss auch vieles nicht.»
«Wir können eine Brücke bauen, aber die ist halt etwas wackelig», sage sie sie oft. «Wir werden sie nicht alleine oder zu zweit bauen können.» Die Themen, die man am Schauspielhaus ständig verhandle, seien eben eingebettet in grössere Systeme. Dass es nicht immer klare Antworten gibt, sei für viele manchmal mühsam oder frustrierend. «Aber wir müssen das zusammen herausfinden, zusammen verhandeln.» Sie pausiert kurz. «Nicht alles», fügt sie mit Nachdruck hinzu. «Es gibt gewisse Themen, die wir nicht mehr aushandeln.»

Mehr Sichtbarkeit und Teilhabe für marginalisierte Positionen seien für sie logisch und «die ganze Links-Rechts-Geschichte ist für meine Arbeit darum ein wenig egal», sagt Dioh. Bevor es um strukturelle und systemische Themen geht, «geht es erst einmal um den Menschen, der dir begegnet.»
Dioh ist darum auch eine offene Anlaufstelle für alle Fragen, die Diversität betreffen. Das bedeute für sie nicht einfach «alle zwei Wochen ein Workshop, sondern man schreibt mir eine E-Mail, man kommt zu mir, wir trinken einen Kaffee und reden darüber. Ich möchte einen positiven Raum schaffen, in dem man lernen kann, aber auch einen Raum, in dem es Platz für Unsicherheiten hat». Und wirkliches Zuhören sei wichtig, nicht Predigen.
Sie würde damit vermeiden wollen, dass Frust und Angst unausgesprochen bleibt, etwa der Glaube, man «könne nichts mehr sagen». «Mir ist wichtig, dass sie sich nicht genieren, mich zum Beispiel zu fragen, wie man richtig gendert». Dioh sieht sich darum nicht als eine Art Woke-Polizistin: «Ich sage dir nicht, du bist scheisse, ich sage dir nicht, du bist ein Arsch – ich zeige dir nur auf, was du tust», erklärt Dioh.
Sie vermeide es, Menschen als Rassisten oder Sexisten zu bezeichnen, es gehe nicht um etwas Essentielles, sondern um das Verhalten, das Tun und «das kann ich lernen und anpassen, ich musste das auch», sagt Dioh, «zum Beispiel, wenn es um antischwarzen Rassismus geht. Ich musste das auch lernen, hatte das selbst auch internalisiert, hatte auch Angst vor Schwarzen Männern», sagt Dioh und sie sagt es gleichermassen mit Ernst, aber auch Empathie. Auch andere People of Color hätten dieses Problem manchmal, etwa, wenn sie in besonders stereotypen Darstellungen unkritisch mitwirken und sagen würden, dass «das doch alles nur ein Spiel ist».
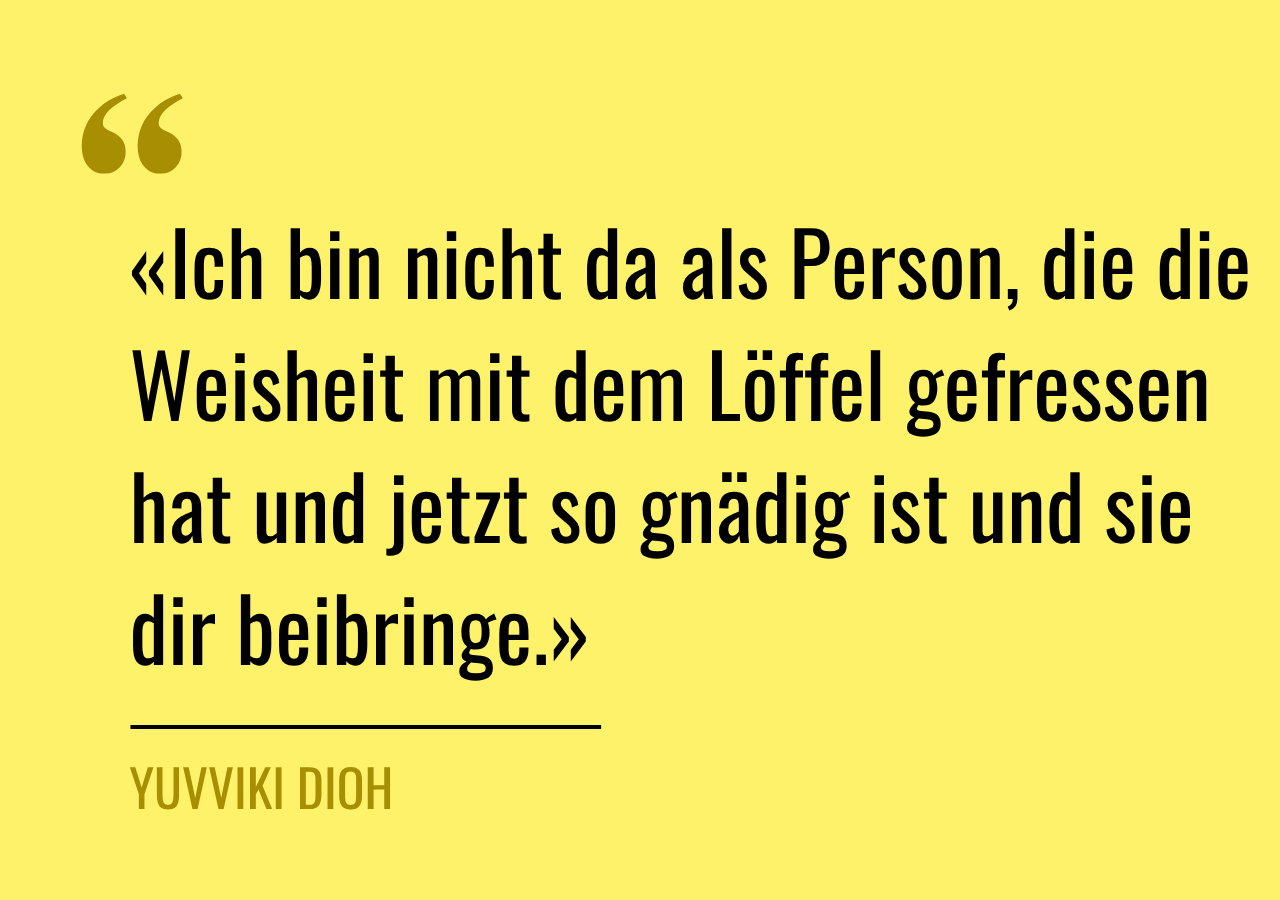
«Ich muss dann verhandeln und sagen: Ja, aber es ist mehr als du. Es ist etwas, das in eine kollektive Erinnerung geht.»
Dann lacht sie. «Ich bin also nicht da als Person, die die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat und jetzt so gnädig ist und sie dir beibringe.»
«Ich musste das alles auch durchmachen und hatte keine Diversitätsagenten. Mein Umfeld, queere und (post-)migrantische Menschen, – wir hatten das Material nicht, sondern haben es uns selbst erarbeitet. Und du müsstest das auch – aber mit mir hast du jemanden, der das mit dir macht und dich unterstützt», sagt Dioh.
«Wenn mich jemand fragt, warum man eine Person richtig gendern soll, arbeite ich mit Beispielen: Du willst doch auch nicht, dass dich jemand beim falschen Namen nennt oder dir ständig er statt sie sagt? Das macht ja etwas mit dir». Angst vor dem falschen Gendern soll man indes nicht haben, denn «das passiert immer wieder, auch queeren Menschen, und die meisten reagieren nicht so, wie du es dir ausmalst und flippen aus. Und wenn es nach einem langen Tag doch einmal einen Konflikt gibt, ist das kein schöner Moment, aber auch nicht so schlimm». Wichtig sei zunächst, es zu probieren, sich Mühe zu geben, Respekt zu schenken, es aufrichtig zu meinen.

Es gehe darum, Empathie füreinander zu schaffen. Eigentlich wollte Dioh lange nicht mit persönlichen Erlebnissen und Beispielen arbeiten, um zu vermeiden, dass man ihre Geschichte als Einzelfall sieht, aber auch, weil sie keinen «Victim Porn» herstellen wolle, wie sie sagt. Sie dachte gar, «mit einer gewissen aktivistischen Ungeduld», sie müsse streng sein, habe aber schnell herausgefunden, dass es ohne zwischenmenschliche Basis nicht geht. Dabei gehe es eben nicht nur um Bedürfnisse bestimmter Menschen, nicht darum gewissen Menschen Dinge zu erlauben, die man anderen nicht zugesteht, denn «wenn du merkst, dass du das Bedürfnis auch hast, können wir darüber reden.»
Eine HR-Kuschelstelle ist Yuvviki Dioh aber keineswegs: «Ich nehme deine Frage ernst. Ich gebe dir auch ernstes Feedback, wenn ich etwas kritisch finde. Das heisst nicht, dass ich etwas gegen dich habe. Es geht wirklich um die Sache», sagt Yuvviki Dioh.
«Zuhören heisst nicht, ich gebe dir recht, aber ich nehme dich ernst. Das ist es, wovor du Angst hast: davor, dass man dich nicht mehr ernst nimmt. Aber das geht anderen Menschen, die nicht deine Lebensrealität teilen, auch so: Sie wollen respektiert und ernst genommen werden. Das kann eben etwas damit zu tun haben, die richtigen Pronomen zu verwenden.»
Ein simpler Punkt, findet Dioh, deshalb sage sie in dieser Situation immer wieder «und mehr ist es nicht.» Der Diversitätsagentin mit akademischem Hintegrund ist bewusst: Das Thema und das dazugehörige Theoriegebäude ist komplex, die Lösungen sind aber, im Grunde, einfach. Oder sie könnten es jedenfalls sein.
Es gebe schon auch schwierige Momente, hin und wieder, sagt Dioh, und manchmal frage sie sich auch, warum es nicht geklappt habe, etwas zu vermitteln, obwohl sie es schon lange versucht hat.
«Der Job beinhaltet ein sehr grosses Frustpotenzial – aber auch ein sehr grosses Glückspotenzial», sagt Dioh. «Progress is not linear», fügt sie hinzu – Fortschritt ist nicht linear.
Sich mit dem Publikum finden
Die grössten Schwierigkeiten gebe es aber nicht durch internen Zwist, sondern durch äusseren Druck. «Ich habe diese Bürden, Lasten und Widerstände viel mehr von aussen erlebt. Etwa durch die Medienkampagne gegen uns, gegen mich», sagt Dioh und spricht damit die NZZ an. «Ich war viel stärker damit konfrontiert, dass vermeintlich grosse Gruppen in unserem Stammpublikum ein Problem mit diesem Kurs haben.»

«Eine laute Minderheit», ordnet Dioh ein, «und leider ein paar Menschen, die relevant für die Kulturpolitik sind».
«Ich führte sehr viele wahnsinnig anstrengende, aber sehr interessante Gespräche, auch, aber nicht nur mit älteren Menschen, die seit jeher ins Theater gehen. Ein paar von ihnen haben eine Aversion gegen Diversitätsarbeit und Wokeness. Zu realisieren, woher diese Aversion kommt, war spannend.»
Nämlich: Eine falsche Gegenüberstellung von Klassikern – «ich finde Klassiker super», ruft Dioh – und Experimenten. Kein Entweder-Oder. Aber genau das sei es, was manche Menschen fälschlich unter Diversität verstünden. Sondern, wieder, um Lebensrealitäten und deren Bedürfnisse. Aber «wenn die Definition der vermeintlichen Bedürfnisse einer klassisch-bürgerlichen Schicht ist ‹Es ist nicht woke›, dann habe ich ein Problem damit», sagt Dioh entschieden. «Keine Angst, wir machen auch Klassiker für euch, aber ich habe Mühe mit dieser Binarität. Dennoch ist es mir wichtig, auch Klassiker zu bearbeiten und sich etwa über rassistische oder sexistische Inhalte Gedanken zu machen – und sie gegebenenfalls auch zu streichen.»
Letztlich sei ihr Job ein Drahtseilakt «kulturpolitischer Institutionslogik», erklärt Dioh. Schauen, «dass das Stammpublikum nicht abspringt» auf der einen Seite, auf der anderen bedeute Diversität auch «das Diversifizieren unserer Kunst und unseres Publikums», auch wenn «ich es hasse, das so Business-like zu formulieren». Das funktioniere immer wieder – auch überraschend.
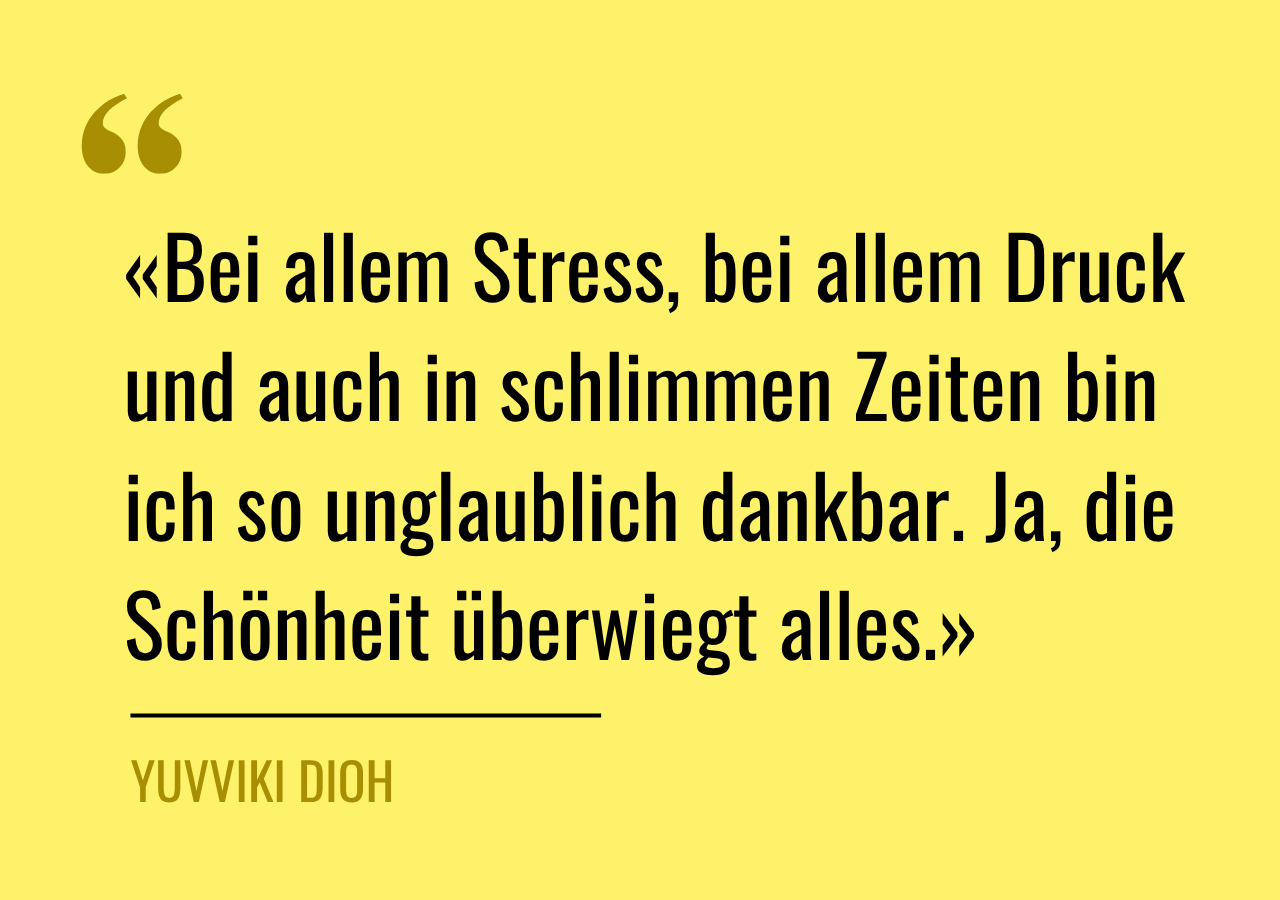
Kürzlich habe man etwa «Die kleine Meerjungfrau» aufgeführt – auf der Bühne drei Drag Queens. Selbstverständlich sei die queere Community in Scharen aufgetaucht, aber auch viele Personen aus dem Stammpublikum, «und alle hatten ein Käferfest», sagt Dioh nun begeistert. Die Vorstellungen seien fast jedes Mal ausverkauft gewesen, so etwas habe sie noch nie gesehen. «Es war wirklich so wunderbar», lacht Dioh beseelt.
Eine Frau aus dem Stammpublikum habe sich mit ihr nach dem Stück unterhalten und gesagt, sie müsse jetzt nachhause gehen, um darüber nachzudenken «warum ich überhaupt so ein Problem damit hatte.»
Obwohl Diversitätsarbeit eine Auseinandersetzung mit schweren Themen bedeutet, gebe es Momente, von denen sie bei ihrer Arbeit zehre. Sie denke dann manchmal «eigentlich ist es mega kitschig, aber es ist doch geil! Es ist doch geil, dass wir so verschieden sind», sagt Dioh, gestikuliert energetisch und lacht. «Stell dir mal vor, alle wären wie ich. So langweilig.»
Dioh muss grosse, schwierige Arbeit tun, gegen viele Widerstände, und muss sich genau darum immer wieder an den kleinen Dingen festhalten, ohne das grosse Ganze aus dem Blick zu verlieren. «Ich glaube nicht, dass man jede Institution einfach so von innen verändern und reformieren kann. Aber ich habe die Hoffnung, dass das beim Theater geht. Weil das Theater immer Fragen an die Welt stellt. Immer.»
Yuvviki Dioh steht nun vor dem Ausgang zum Schiffbau. Der Morgen verschwimmt bald zum Mittag. Zeit für eine Zigarette. Das Proben geht bald los. Immer mehr Leute trudeln beim Schiffbau ein. Dioh grüsst lachend, ein lautes «Hey!» links, ein händewinkendes «Hoi!» rechts.
«Bei allem Stress, bei allem Druck und auch in schlimmen Zeiten bin ich so unglaublich dankbar. Ja, die Schönheit überwiegt alles.»