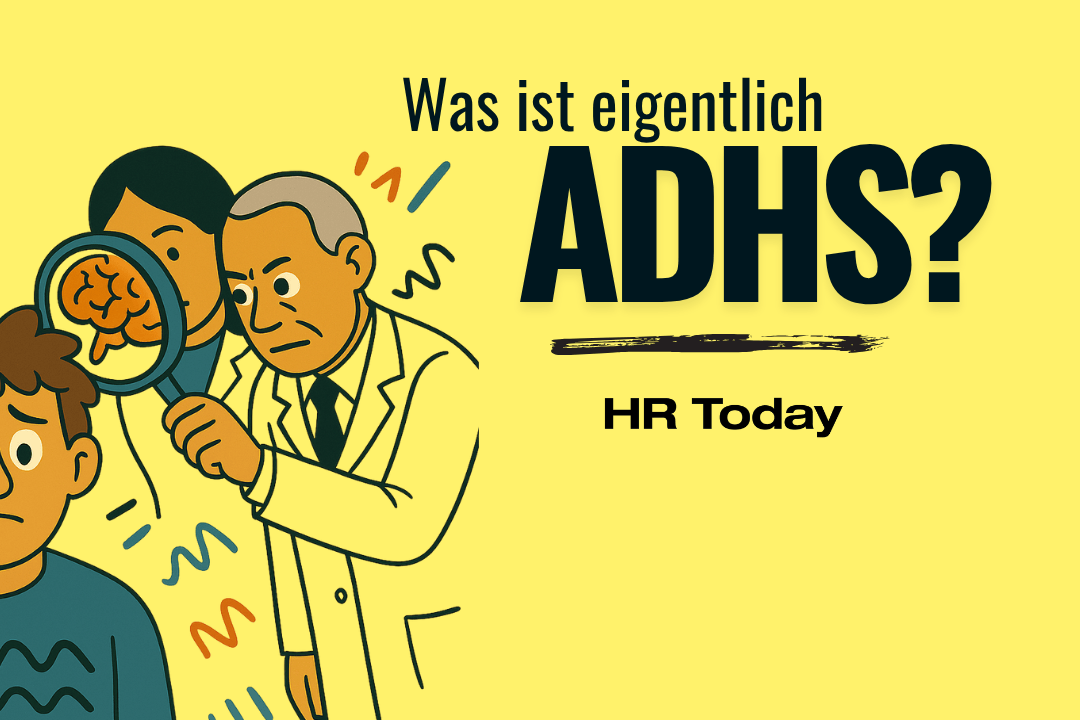Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind
ADHS wird oft diskutiert, als sei es ein Streitfall. Doch hinter jeder Diagnose steht ein Mensch – und hinter jeder Debatte ein System, das Entscheidungen erzwingt. Wer nur über Fehldiagnosen spricht, ignoriert, warum sie entstehen.
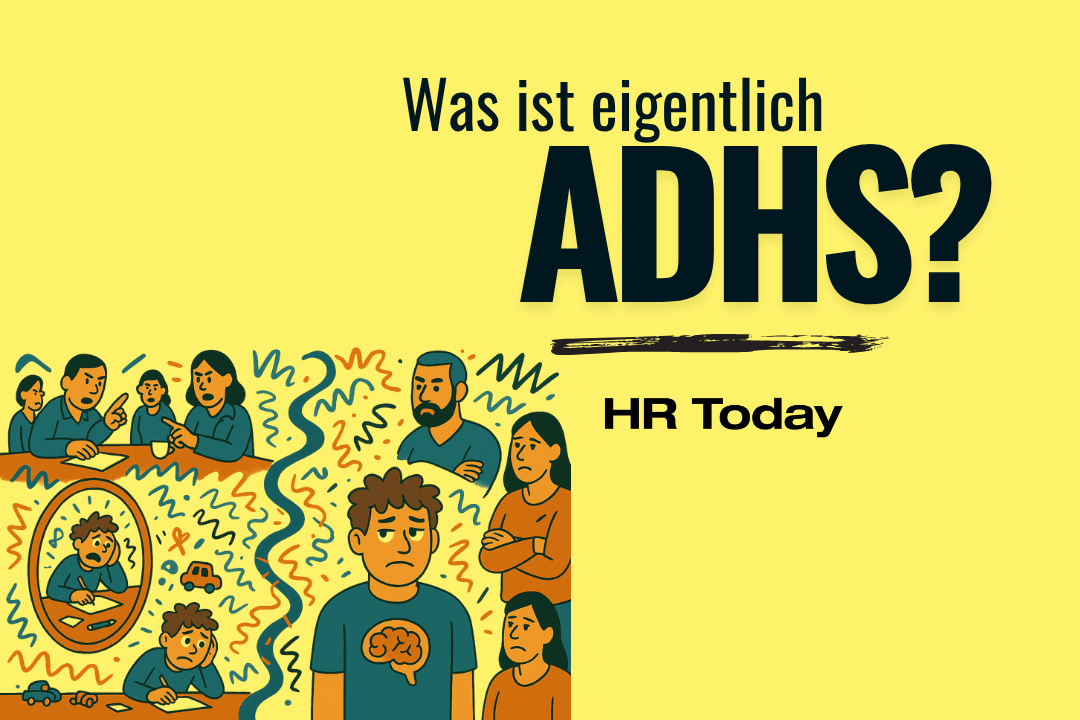
Im letzten Kapitel haben wir – erneut, aber auf andere Weise – herausgefunden: So einfach lässt sich ADHS gar nicht definieren. Die Unklarheit in der interdisziplinären Forschung ist dabei nicht eine Schwäche, denn Forschung trägt in jedem Fall dazu bei, die «Tatsache ADHS» besser zu verstehen. Herrscht aber in der öffentlichen Debatte Verwirrung, führt das oft zu falschen Fragen. Und genau darum geht es in diesem Kapitel.
Die Sommerserie im Überblick
Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun
Intro – Am Anfang war der Montag
Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos
Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: ADHS zwischen Biologie und Gesellschaft
Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Hirn – entpolitisiert
Sie sind hier: Kapitel 4 – Zu viele ADHS-Diagnosen? Falsche Frage
Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt

Es werden Stellvertreterdiskussionen und Scheindebatten geführt– statt auf die Bedürfnisse Betroffener zu hören. (Bild: ChatGPT / rs / Canva)
Da die Frage «Was ist eigentlich ADHS?» sich nicht so leicht beantworten lässt, führt das im öffentlichen Diskurs zu fehlgeleiteten Folgefragen – und damit zu wirkungslosen bis destruktiven Schein- und Stellvertreterdebatten, die Betroffenen kaum hilft. Die Unklarheiten, die beim Wunsch nach fixen Definitionen entstehen, werden allenthalben genutzt, um das Unbehagen – nicht Lösungen – in den Vordergrund zu rücken. Es sind Scheindebatten, die man auch bei anderen öffentlichen Diskussionen über Minoritäten immer wieder antrifft. Zum Beispiel bei einem Thema, das oberflächlich, auf den ersten Blick, eigentlich nichts mit ADHS zu tun hat – sich bei näherer Betrachtung schnell zeigt, dass sie verknüpft sind.
Ein solches Muster zeigt sich beispielsweise in der erbittert geführten Diskussion um trans Menschen, die häufig auf eine scheinbar grundlegende Frage zugespitzt wird: «Wenn jemand einfach das Geschlecht wechseln kann, wer ist denn wirklich ein Mann, wer eine Frau?» Die Parallele an dieser Stelle: Genau wie ADHS ist auch Gender Teil eines interdisziplinären Forschungsfeldes und genau wie auch bei ADHS lässt sich die Frage nach dem Geschlecht nicht einfach genetisch oder biologisch vollständig klären – auch bei ihr müsste man auch nach sozialen Dimensionen fragen.
«Der Diskurs dreht sich bei ADHS oft um Scheindebatten, die man auch bei anderen öffentlichen Diskussionen über Minoritäten immer wieder antrifft – zum Beispiel beim Thema Gender.»
Doch die bis zur Erschöpfung debattierte Frage darum, wer denn nun «tatsächlich» eine Frau ist, bewirkt am Ende wenig – oder ist gar destruktiv. Kurzum: Über diese Frage wurde man sich in den letzten 2000 Jahren nicht einig und man könnte sich noch 2000 Jahre länger ohne Lösung damit befassen. Statt uns zu aktiv zu fragen, was die genderdiverse Realität über unseren Umgang mit Gender und gesellschaftlichen Kategorien im Allgemeinen bedeutet, verhindern wir mit solchen Nebenschauplatzpolemiken das Reagieren auf aktuell real existierende Bedürfnisse zugunsten einer abstrakten Diskussion. Wir verhindern bisweilen, dass Betroffene jene soziale und – falls gewünscht – therapeutische Unterstützung kriegen, die ihnen nicht nur das blosses Überleben sichern, sondern es ihnen ermöglichen, sich als Menschen zu entfalten.
Dasselbe Hindernis gilt für die Frage «Wer hat wirklich ADHS?» Kann man sie stellen, ohne in eine ewige Diskussionsschlaufe zu geraten, während Betroffene daneben stehen und darauf warten, dass es endlich in der konkreten Realität weitergeht? Und selbst wenn man die Antwort zufällig fände: Ändert das etwas an den Lebensbedingungen der Betroffenen?
Eine weitere Parallele zur Debatte um Gender: Sowohl bei ADHS als auch bei trans und non-binären Menschen wird über einen angeblichen Anstieg von Diagnosen und verschriebenen therapeutischen Massnahmen diskutiert.
Bei beiden Debatten stehen dadurch plötzlich klinische Diagnosen selbst im Mittelpunkt: Wie valide sind die diagnostischen Kriterien? Wird falsch oder zu häufig diagnostiziert – und was sagt das über die «Tatsache ADHS» aus? Oder haben wir zu viel Bildschirmzeit? Zu viel Social Media – werden unsere Kinder durch TikTok zu ADHS oder diverser Geschlechtsidentität «verleitet»? Die Fragen sind in dieser Form omnipräsent im medialen Diskurs. Sie befeuern vor allem eines: die Scheindebatte um Gültigkeit. «Wer hat denn nun wirklich ADHS?», – als ob eine Diagnose ein exklusiver Status, den es vor Trittbrettfahrenden zu schützen gilt. Der implizite Vorwurf: Du hast es nicht wirklich, du bist nur so. Am Schluss würde auch eine perfekte Diagnostik und lückenlose Hirnscans nichts daran ändern, dass sich auch Menschen ohne Diagnose so verhalten, so fühlen, so handeln können, als ob sie ADHS hätten. Was macht man mit diesen Menschen?
Trotzdem lassen wir uns auch hier auf diese Fragelinie ein. Was ist denn wirklich dran am angeblichen Diagnose-Boom?
Von Fake-Diagnosen, Geld und Macht
Der Anstieg an ADHS-Diagnosen lässt sich zwar erklären, hat aber gleich mehrere Facetten – und das mit verblüffender Ähnlichkeit wie beim Thema Gender:
«Der Anstieg der Diagnoseraten hat mehrere Gründe», erklärt ADHS-Expertin Elena Haegi, die wir bereits im letzten Kapitel kennengelernt haben. «Einerseits besseres Wissen und eine breitere Aufklärung über ADHS, sowie bessere Gesundheitssysteme, jedoch auch Abklärungen, die auf schnelle Resultate abzielen und sich auf wenig verlässliche Bewertungsverfahren stützen.»
Wer heute eine ADHS-Abklärung möchte, muss unter Umständen mit langer Wartezeit rechnen – nicht selten mehrere Monate. Noch schwieriger wird es, wenn man auf ADHS spezialisierte Therapeutinnen und Therapeuten sucht. Kurz: Anbietende von ADHS-Therapien stehen selbst unter Druck: Zu viele Menschen, zu wenige Ressourcen. Eine umfassende Abklärung, so, wie es sich Kritiker und Kritikerinnen gerne wünschen, existiert in dieser Form nicht. Das Resultat: Am Ende warten Betroffene, weil die «perfekte Lösung» erst noch ausdiskutiert werden muss und bis dahin die Unterstützung mangelhaft ist.
Die Abklärung läuft in vielen Fällen ähnlich: Eine Bestandesaufnahme über Fragebögen, Tests zur Abgrenzung etwa von Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen, manchmal auch kognitive Tests. Doch selbst eine gründliche Abklärung heisst: Spielraum für Interpretation. Insbesondere, da die in den letzten Kapiteln erwähnten Diagnose-Manuale Schwierigkeiten dabei haben, sich neurowissenschaftlich abzustützen – und sich daher pragmatisch an der klinischen Realität orientieren. Nicht zuletzt sind sich auch ADHS-Therapeutinnen und Therapeuten nicht in allen Diskussionen rund um ADHS einig. Das heisst: Aufnehmen, was man aufnehmen kann – und daraus Schlüsse ziehen. So funktioniert der medizinische Alltag.
«In den USA wurden schlechter abschneidende Schulkinder in sozioökonomisch benachteiligten Schulen fälschlicherweise mit ADHS diagnostiziert.»
– Elena Maja Haegi
Dieser eigentlich alltäglichen Unklarheit begegnet der öffentliche Diskurs mit Skepsis: Die ADHS-Diagnoseraten steigen, verschriebene Medikation ebenfalls. Die Frage: Läuft hier etwas schief? Wird falsch oder unsorgfältig diagnostiziert? Diese Fragen fokussieren sich, kein Wunder, darum direkt auf den Diagnoseprozess. Dabei wird ausser Acht gelassen, dass auch dieser Diagnoseprozess nicht nur in einen wissenschaftlichen, sondern auch in einem wirtschaftlichen und politischen Umfeld eingebettet ist.
Denn: Die Bewertungsverfahren sind wegen der ihnen zugrundeliegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Fehlanreizen ausgeliefert: «Zu den bereits genannten Gründen kommen medizinische und bildungspolitische Massnahmen, die die Diagnoseraten fälschlich aufblähen, wie zum Beispiel in den USA in den frühen 2000ern nachgewiesen wurde», erläutert die ADHS-Forscherin.
Haegi weiter: «Dort wurden zum Beispiel schlechter abschneidende Schulkinder in sozioökonomisch benachteiligten Schulen fälschlicherweise mit ADHS diagnostiziert.»
Der Grund: Diesen Schulen standen damals unter dem Druck, ein gewisses mit Tests verbundenes Leistungsniveau zu erreichen. Andernfalls drohten finanzielle Konsequenzen – in Form gekürzter Mittel durch die öffentliche Hand. Oder konkreter formuliert: Leiden Schulbezirke unter ihren wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen, kann eine Diagnose plötzlich zu einem ökonomischen Instrument werden, um diese Nachteile wieder auszugleichen. Die entsprechenden Schulen haben also Diagnosen gestellt, im Versuch Löcher zu stopfen, die ohne die Diagnosen noch grösser geworden wären – mit noch mehr Nachteilen für die Schülerinnen, Schüler und den ganzen Schulbezirk.
Das Dilemma ist hier also nicht einfach das Diagnoseverfahren an sich – oder gar ADHS als Ganzes –, sondern das, was eine Diagnose leistet und leisten soll. Falschdiagnosen sind in diesem Kontext nicht einfach ein Zeichen von Missbrauch, sondern ein logisches Resultat einer strukturellen Schieflage. Die Fehldiagnosen machen deutlich, wie ökonomischer Druck am Ende auch diagnostisches Handeln formen kann – und dass hinter jeder vermeintlich «überzogenen» Diagnose auch ein nicht eingelöstes soziales Versprechen stehen kann. Insofern ist es kaum überraschend, dass Diagnosen zu einer Währung werden, wenn bereits Leistung als Währung gehandelt wird – und all das in einer Logik systemischer Knappheit.
Doch das wirtschaftliche Performancestreben – gewissermassen im Spannungsverhältnis mit den nicht eingelösten sozialen Versprechen – hat hierbei also nicht nur einen Einfluss auf Schulen als Institutionen, sondern auch auf Menschen an sich:
«Zudem wurde nachgewiesen, dass der Leistungsdruck eines effizienz- und erfolgsbasierten Systems nicht nur Menschen mit ADHS negativ beeinflusst, sondern auch selbst zu einem Verhalten beitragen kann, das als ADHS-typisch gilt – was wiederum zu einer Zunahme der Diagnosen führt», erklärt ADHS-Expertin Elena Haegi.
Fluide Menschen und fluide Kategorien
Eine solche wechselseitige, spiralartige Dynamik beschrieb auch der kanadische Wissenschaftstheoretiker Ian Hacking in seinem 1995 erschienenen Buch «Menschenarten» als Looping-Effekt. Er formulierte darin anhand verschiedenster Beispiele eine These darüber, wie bestimmte «Menschentypen», die bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen miteinander teilen, klassifiziert und gruppiert werden. Die Art und Weise, wie man Menschen klassifiziert – und die anschliessenden Konsequenzen – verändern wiederum das Verhalten von Menschen, was sich wiederum auf diese Klassifikationen auswirkt. Oder einfacher formuliert: Die Messlatte verschiebt sich ständig. Ein Versuch, Menschen mit Diagnosen zu beschreiben, jagt den nächsten.
Mit Diagnosen verhält es sich jedoch genau wie mit den noch lückenhaften Forschungsergebnissen aus der Neurowissenschaft: Sie sind keineswegs sinnlos oder sollten verworfen werden. Im Gegenteil. Wie Psycholinguistin Elena Haegi erklärt, was Diagnosen leisten können: «Sie stellen ein Grundgerüst dar, an deren Eckpunkten Betroffene sich orientieren können».
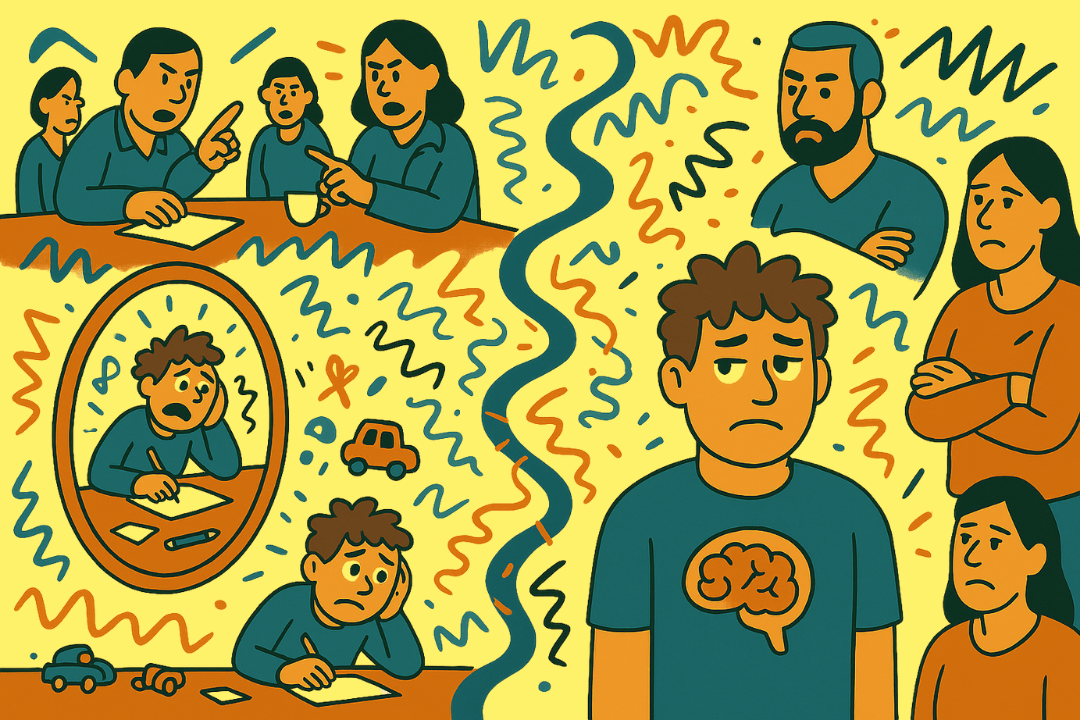
Wie wir Menschen kategorisieren, hat einen Einfluss darauf, wie sie sich selbst sehen und wie sie sich verhalten. (Bild: ChatGPT)
Doch mit dem Fokus auf diagnostische Massnahmen geht das schnell vergessen. Während Kritik an Diagnoseverfahren selbstverständlich wichtig ist, sollte sie nicht dazu dienen, ADHS als Ganzes in Frage zu stellen – oder jenen Menschen zu misstrauen, die Unterstützung brauchen.
Wenn wir unsere Bewertung von Menschen von einer Diagnose abhängig machen, etwa mit der Frage «Ist diese Person einfach faul und unmotiviert oder hat sie ADHS?» ignorieren wir nicht nur ihre Bedürfnisse, indem wir diese in gerechtfertigt und ungerechtfertigt einteilen. Wir stellen auch eine Frage, die wir so – mit allem, was wir aus dieser Serie bisher gelernt haben – gar nicht beantworten können, jedenfalls nicht in der Kürze, die der öffentliche Diskurs, gekettet an die mediale Aufmerksamkeitsökonomie, es verlangen würde. Und daher auch nicht mit der nötigen Komplexität.
Tatsächlich wird die Frage trotzdem immer wieder gestellt, leider auch zwangsläufig. Denn ohne Diagnose wird es schwierig, wenn es beispielsweise um Unterstützung oder institutionalisierte Massnahmen wie um Nachteilsausgleiche in der Schule, an der Universität oder am Ausbildungsplatz geht.
Das ist doppelt tragisch: Denn so verkommt eine Diagnose einerseits zu einem pro forma Bürokratie-Ritual, bei dem Betroffene ihre Betroffenheit beweisen müssen, andererseits bedeutet es auch, dass Menschen mit ADHS aktuell der Pathologisierungsfalle nicht entkommen können. Konkret: Um das Bedürfnis nach Unterstützung äussern zu können, braucht es einen feststellbaren Defekt.
Im nächsten Kapitel gehen wir auf die nächste Scheindebatte ein: Jene um Medikation im Allgemeinen – und Ritalin im Speziellen.
Weiter zu Kapitel 5: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt
Die ADHS-Sommerserie erscheint in wöchentlich ein bis zwei Kapiteln. Wir informieren Sie jeweils über unseren Spezial-Newsletter, sobald neue Teile erscheinen.
Wir haben schon einige Rückmeldungen auf unsere ADHS-Serie erhalten. Darunter: Dank, Fragen, eigene Erlebnisse. Ich möchte diese Nachrichten gerne in eines der späteren Kapitel einfliessen lassen. Haben Sie Fragen, Input – oder möchten Ihre eigenen Erfahrungen zu ADHS mit mir teilen? Schreiben Sie an robin.schwarz@hrtoday.ch