Die grosse ADHS-Sommerserie: Am Anfang war der Montag
In der grossen HR-Today-Sommerserie gehen wir der Tatsache ADHS auf den Grund, schauen in die Geschichtsbücher, dröseln Kontroversen und Scheindebatten auf. Aber zuerst beginnen bei einem ganz (un)normalen Montag.

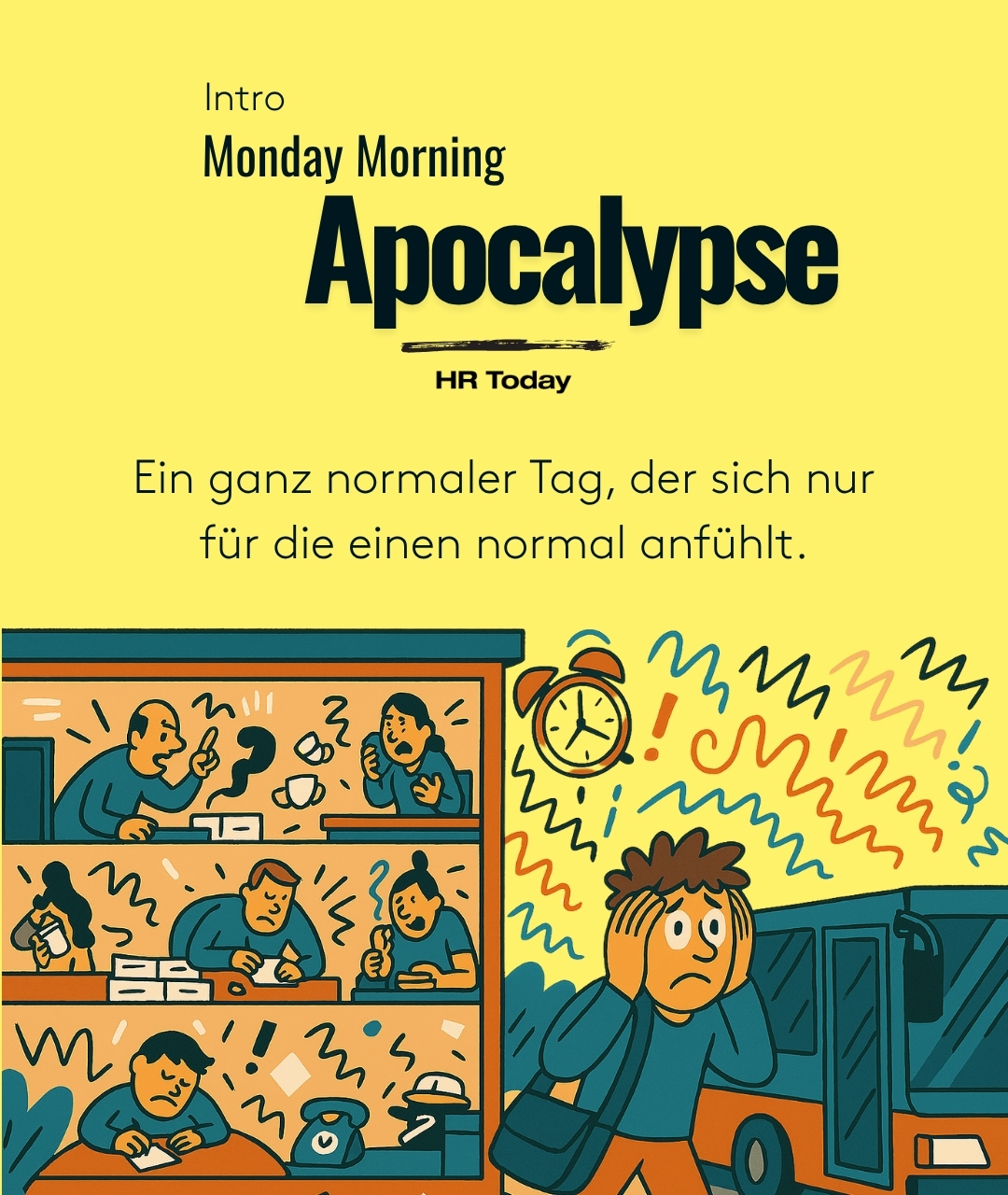
Montagmorgen.
Das Wochenende war nicht so erholsam, wie Sie es sich erhofft hatten. Vielleicht war da ein Konflikt im Freundeskreis, der Ihnen sonst immer Halt gibt. So ganz können Sie die Gedanken nicht daran hindern, sich immer wieder in den Vordergrund zu drängeln, als ob Ihr Kopf der überfüllte Bus wäre, der Sie gerade mit desaströser Verspätung an Ihren Arbeitsplatz gebracht hat. Und erst die Leute! Laut und rüpelhaft. Es ist der montagigste Montag aller Montage.
Apropos Montage: Sie müssen heute früher nachhause, weil sich spontan ein Elektriker gemeldet hat, der von der Gemeinde beauftragt wurde, ausgerechnet bei Ihrem Haus ein Glasfaserkabel zu verlegen und entsprechende Gerätschaften zu montieren.
Dabei müssten Sie eigentlich selbst noch auf die Gemeinde, die unerklärlicherweise absurd kurze Öffnungszeiten hat, was Sie – obwohl Sie natürlich wissen, dass dem nicht so ist – als eine Art absichtliche persönliche Beleidigung empfinden.
Ihre Pendenzen stapeln, nein, türmen sich aber auch auf der Arbeit. Im Grossraumbüro rhabarbern Ihre Mitarbeitenden kreuz und quer und als ob das noch nicht genug der Misere wäre, flicken Bauarbeiter vor Ihrem leider schlecht isolierten Fenster die Strasse, weshalb ein Presslufthammer in unregelmässigen Abständen durch Ihren Schädel rattert.
Ihr Chef gibt Ihnen eine kafkaeske Aufgabe, deren Sinn sich Ihnen beim besten Willen nicht erschliesst: Sie sollen mehrere Dossiers à 100 Papierblätter auf Kleinigkeiten überprüfen, korrigieren und neu ordnen, aber irgendjemand unterbricht Sie alle zwei Minuten. Und – oh Schreck! – obwohl Sie doch erst gerade am Arbeitsplatz angekommen sind und sich endlich dazu durchringen konnten, die Aufgabe zu erledigen, ist es schon Mittag.
Die beiden Kollegen neben Ihnen schaufeln sich aus Zeitgründen ein Thunfischsandwich und eine Portion Spaghetti aglio e olio direkt am PC zwischen die Kiefer. Sie reagieren – Sie würden sagen: gerechtfertigterweise – etwas ungehalten und nun hängt Spannung und Unfriede genauso in der Luft wie das Miasma des Mittagessens.
Es ist unerträglich. Nicht nur in Ihnen, sondern auch um Sie herum herrscht der absolute Ausnahmezustand.
Die Sommerserie im Überblick
Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun
Sie befinden sich hier: Intro – Am Anfang war der Montag
Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos
Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: Die Lücke im Hirnscan
Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Gehirn – entpolitisiert
Kapitel 4 – Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind
Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt
Kapitel 6 – Wer therapiert hier eigentlich wen?
Wie Sie diese Serie am besten lesen
Sie wird sich in mehrere thematische Kapitel gliedern und von allen Seiten und entlang der gängigsten Linien des Alltagsdiskurses über das Thema ADHS – und Dingen, die vielleicht mehr damit zu tun haben, als Sie auf den ersten Blick glauben werden – Schritt für Schritt erörtern.
Ich möchte Sie ermutigen, jedes Kapitel zu lesen. Denn in dieser Serie umkreisen wir immer wieder ähnliche Punkte, als würden wir uns wie eine Doppelhelix durch das Thema schrauben und immer wieder, mit etwas neuem Wissen, an Dingen vorbeikommen, die uns irgendwie bekannt vorkommen (haben Sie es gemerkt?).
Das Ziel: Wir nehmen so viele Wege wie möglich, um zu sehen, wo es Lücken gibt, wo wir auf Hindernisse stossen – und überlegen uns, wo es nötig ist, eine Leiter hinzustellen und wo es sich eher lohnt, einen anderen Pfad zu gehen.
Falls Sie sich als HR-Managerin oder -Generalist einfach eine Liste mit Tipps erwarten: Bevor Tipps etwas bringen wäre es, gerade in dieser Angelegenheit, sinnvoller, zuerst zu verstehen, weshalb diese Tipps funktionieren. Und: Bevor wir – gerade in HR-Abteilungen – nicht ein gemeinsames Verständnis für ADHS schaffen, werden Tipps wirkungslos bleiben.
Und falls Sie sich beim Lesen womöglich fragen: Warum benutzt dieser Journalist so viele Klammern? (und dann sogar Einschübe in den Klammern – das ist ja nicht zu ertragen!), dann deshalb: ADHS steckt in allem. Auch im Schreiben, in der Sprache. Oder wie es jemand auf Twitter einst formulierte: Jeder Gedanke kommt mit zusätzlichem Bonus-Content. Ich habe mich bewusst entschieden, so zu schreiben, wie ich denke. Von Sätzen bis zum Aufbau. Denn auch das kann vielleicht ein Verständnis dafür schaffen, wie Menschen mit ADHS nicht nur empfinden, sondern auch denken.
Trotzdem – oder gerade deswegen – wird jedes Kapitel auch mit einer kleinen Wiederholung und Links zur vorherigen Story beginnen.
Wir drehen den Spiess um
Falls Sie sich jetzt schon denken: «Das klingt jetzt schon wie eine Schulstunde!», obacht!
Denn wir beginnen bei Geschichte. Aber keine Sorge. Jahreszahlen müssen Sie keine auswendig lernen. Im Gegenteil. Hier geht es um Zusammenhänge. Denn die Geschichte – von der wir ja, manche mögen da überrascht sein, Teil sind – ist ein konstantes Entfalten von Prozessen, die allesamt ihre Vorbedingungen haben.
Nur wenn wir die «Tatsache ADHS» als Teil der Geschichte, als ein Ergebnis von verschränkten Prozessen materieller, wissenschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Diskurse begreifen, können wir uns auch selbst darin verorten. Wir versuchen also quasi – Achtung, wieder ein Begriff wie direkt aus der Schulstunde – eine Art Triangulation.
Anders als in den meisten Schulstunden (lassen wir denn das Thema «oral history» – manche von Ihnen erinnern sich womöglich – beiseite) steht hier im Zentrum aber kein top-down vorgegebener Lehrplan.
Wir drehen das um und fragen uns aus Sicht von Menschen mit ADHS – quasi bottom-up –, was die Probleme des vorgegebenen Lehrplans sind – aber auch, was daran gut ist. Gewissermassen sind wir also hier eine Art Klasse voller ADHS-Kinder, die den Lehrpersonen nervige Fragen stellen. Nervig darum, weil die Lehrperson genau weiss, die Sache ist kompliziert, aber wir haben nicht einmal eine Doppelstunde.
So dekonstruieren wir – gemeinsam – eine ganze Menge Unsinn.
Zunächst beugen wir direkt einem Missverständnis vor. Denn obwohl der Begriff «ADHS» – die Abkürzung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung – vordergründig ein diagnostischer Begriff ist, hat das, was wir im Alltag als ADHS bezeichnen, nie rein mit einer Diagnose zu tun.
Lassen Sie uns Ballast abwerfen
So funktioniert Sprache: Ein Wort, so spezifisch es vielleicht gemeint sein mag, entfaltet ständig neue Bedeutungen – selbst während des Gesprächs – und kann irgendwann einmal, ganz egal, was seine etymologische Vorgeschichte ist, viele verschiedene Dinge bedeuten und mitmeinen.
Hier geht es also, genau wie in diesem gesamten Artikel, weniger darum, einem Ideal dessen zu entsprechen, «wie es denn wirklich ist oder sein soll», sondern um Outcomes: Wenn 90 Prozent der Menschen also etwas Bestimmtes unter dem Begriff ADHS verstehen, macht es wenig Sinn, zu sagen «das ist aber nicht, was das Wort heisst».
Schliesslich würden Sie sich auch nicht auf eine Diskussion darüber einlassen, ob Gazpacho denn nun eine Suppe ist, weil gemäss Ihrer Definition eine Suppe warm sein muss, während die andere Person findet, nein Suppen können auch kalt sein. Lieber reden wir also über all das, was unsere Sprache so mit sich trägt.
Damit befreien wir uns vom ersten Ballast und von der ersten sprachlichen Illusion, ADHS sei auf einen puren, diagnostischen Begriff zu reduzieren. Das erlaubt uns nämlich, auch den Wandel der Diagnose in einem historischen und politischen Spiegel zu sehen – und kritisch zu hinterfragen.
Und das ist bitter nötig, denn die ADHS-Diagnose hat sich durch die Geschichte stark gewandelt. Sämtliche klassischen Symptome in den Diagnose-Handbüchern – etwa innere Unruhe, Bewegungsdrang oder Ablenkbarkeit – sind selbstverständlich schon so lange verbürgt, wie Menschen schreiben können. Doch gerade darin, wie diese Symptome zusammengefasst und benannt werden, verbirgt sich bereits der erste wichtige Hinweis.
Aber erneut, alles der Reihe nach (sagte kein Mensch mit ADHS je wirklich freiwillig).
Weiter zu Kapitel 1: Eine Geschichte mit Chaos – über Chaos
Haben Sie Fragen, Input – oder möchten Ihre eigenen Erfahrungen zu ADHS mit mir teilen?




