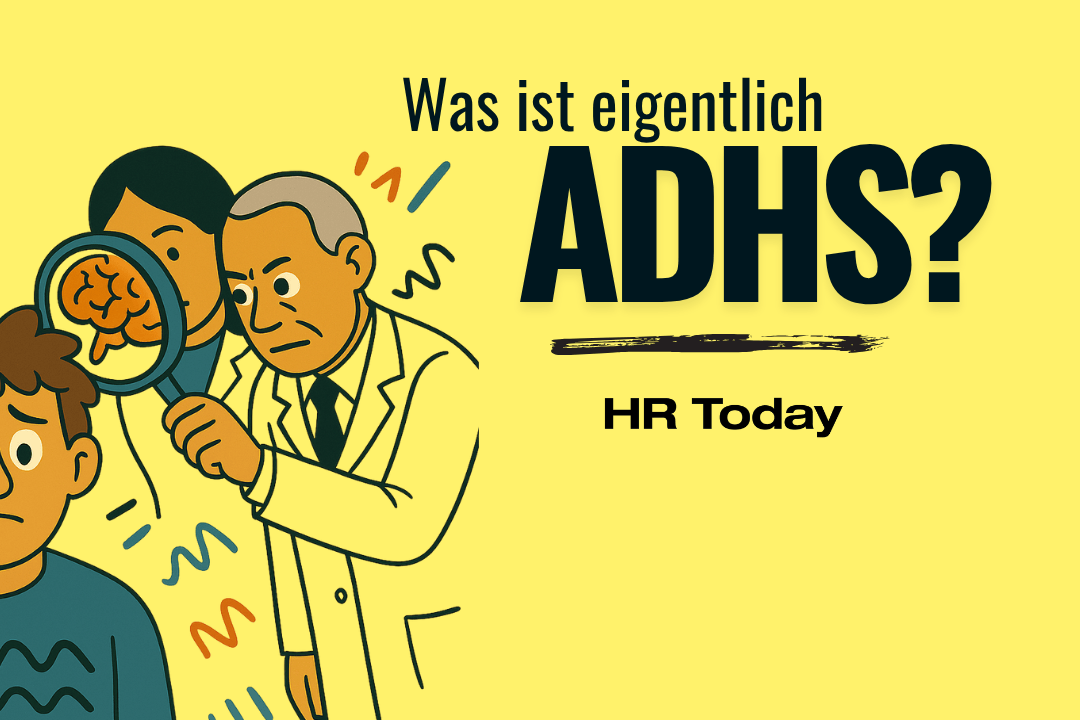ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt
Immer mehr Diagnosen, immer mehr verschriebenes Ritalin – und ein öffentlicher Diskurs, der reflexartig Misstrauen sät. Was hinter der Debatte um ADHS wirklich steht, zeigt sich in der Art, wie wir über Abweichung sprechen.

Im letzten Kapitel haben wir zusammen gelernt: Aus der offensichtlich schwer zu beantwortenden Frage «Was ist denn eigentlich ADHS?» kreieren insbesondere Medien, wieder ähnlich wie beim Thema Transidentität, eine irreführende Folgefrage: «Wer hat denn nun wirklich ADHS?», die sich an einem Anstieg von Diagnosen und der Verschreibung von Medikamenten orientiert – und am «Kindeswohl».
Die Sommerserie im Überblick
Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun
Intro – Am Anfang war der Montag
Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos
Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: Die Lücke im Hirnscan
Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Gehirn – entpolitisiert
Kapitel 4 – Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind
Sie befinden sich hier: Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt

Kaum ein Wort steht in der aktuellen Debatte um ADHS so als Stand-in für diese Skepsis. Ritalin – das bekannteste Methylphenidat-Präparat, längst ein kulturelles Symbol geworden. Die Debatte über die Verschreibung von Ritalin ist altbekannt – sie findet beinahe mit der zuverlässigen Regelmässigkeit der Fussball-WM statt.
Erst kürzlich interviewte beispielsweise der «Tages-Anzeiger» den ADHS-Experten Michael von Rhein, um, wie es der Interviewer, Journalist Felix Straumann, formulierte, den «Ritalin-Boom» einzuordnen. Anlass dazu: Die Verschreibung von ADHS-Medikamenten – primär Stimulanzien wie Methylphenidat – bei Kindern ist in der Schweiz in den letzten drei Jahren um 50 Prozent gestiegen.
Die Implikation: Das soll so nicht sein, da läuft etwas schief.
Während es hier zum einen um eine grundlegende Skepsis gegenüber ADHS geht, vermischt sich diese Skepsis aber auch mit den Konsequenzen dieses Anstiegs – sprich gesundheitspolitischen Fragen: Kann unser Gesundheitssystem in Zeiten, in denen jedes Jahr von einem neuen «Prämienschock» die Rede ist, die Kosten für die Medikation stemmen? Oder ehrlicher gefragt: Nimmt man ADHS genug Ernst, um die Kosten für die Medikation stemmen zu wollen? Wenn ja: Wie lange noch? Müsste es strengere Kriterien bei der Verschreibung von Stimulanzien geben? Und wer bezahlt die begleitenden Therapien? Oder ist die Skepsis gegenüber ADHS, Medikation und Therapien so gross, dass man nicht nach Lösungen, sondern nach Problemen sucht?
Der Tages-Anzeiger doppelte kurz später mit einem Folgeartikel nach und fragte sich – direkt im Titel – ob nicht etwa die Schule und Lehrpläne die «Schuld» am «Ritalin-Boom» trüge. Das ist wenig verwunderlich, sind mit der ADHS-Diagnose (und Medikation als gefühlter vermeintlicher Marker einer Diagnose) auch institutionelle und soziale Fragen verbunden: Wer erhält an Schulen oder Universitäten Zugang zu Nachteilsausgleichen – und damit zum Beispiel mehr Zeit an Prüfungen oder die Möglichkeit, alleine in einem Prüfungsraum zu sitzen, statt mit vielen anderen Menschen? Oder nimmt man die Probleme, die an der Schule herrschen, als Zeichen für das Scheitern der integrativen Schule?
Misstrauen ist kein guter Ratgeber – auch nicht für HR-Profis
Das Problem geht aber über die Schule hinaus – denn auch Erwachsene mit ADHS bekunden im Arbeitskontext oft Mühe und haben spezifische Bedürfnisse. Personalverantwortliche und Führungskräfte sind ebenfalls häufiger mit Diagnosen unter Mitarbeitenden konfrontiert, die eigentlich ein Handeln fordern.
Stellt man Skepsis und den «zu behebenden Defekt» ins Zentrum, stellt man sich plötzlich ebenfalls Fragen, die positive Bedingungen für neurodivergente Menschen eher verhindern statt begünstigen: Welchen Mitarbeitenden ermöglicht man vielleicht ein Einzelbüro, Rückzugsräume und flexiblere Pausen? Mit welchen Mitarbeitenden geht man nachsichtiger um, etwa wenn es um Dinge wie Deadlines, langes Stillsitzen in Meetings oder Zuspätkommen geht – und mit wem nicht? Kurz: Wem ermöglicht man gefühlte « neurodiverse Benefits» und wen exkludiert man davon? Fatal ist ein Schluss, den man in diesem Zusammenhang oft hört: Wir können solche Dinge nicht einführen, weil man sie sonst für alle einführen müssten.
«Fatal ist ein Schluss, den man in diesem Zusammenhang oft hört: Wir können solche Dinge nicht einführen, weil man sie sonst für alle einführen müssten.»
Führt man die Diskussion um ADHS entlang dieser Fragelinien, begibt man sich – wie diese Serie zeigt – auf eine ewige Odyssee, statt die tatsächlich relevante Frage zu stellen: Was kann man tun, um Betroffenen ein Leben zu ermöglichen, in dem sie sich tatsächlich entfalten und ihre Potenziale ausschöpfen können.
Zurück zum vorhin angesprochenen Interview im «Tages-Anzeiger»: Denn durch die Fragen des Journalisten zieht sich ein roter Faden: Misstrauen. Misstrauen gegenüber Medikation und jenen, die sie verschreiben, gegenüber der Diagnose und jenen, die sie stellen – aber auch: gegenüber Betroffenen. Dabei geht es im Kern erneut um eine Art individuelles «moralisches» Scheitern. Da ist die Rede von übermässigem Handykonsum bei zu wenig Bewegung, fehlgeleiteter Erziehung und sogar etwaiger falscher Ernährung. Die Geschichte der Diagnose ist – siehe frühere Kapitel – ist spürbar präsent. Die Botschaft: Wer sich richtig verhält, braucht keine Medikamente.
Hier wird – eng verbunden mit der unterkomplex geführten Debatte um Überdiagnostizierungen – impliziert, dass die Verschreibungen von Ritalin eigentlich nicht notwendig sind, weil die mit ADHS in Verbindung gebrachten Symptome die Folge von Social Media oder der integrativen Schule sein könnten.
Zwar kann man durchaus über den Effekt von Social Media (siehe der Looping-Effekt im letzten Kapitel) diskutieren, gegen einen individuell gesunden Lebensstil ist nichts einzuwenden und die Frage nach dem Schulsystem wäre im richtigen Kontext sogar begrüssenswert. Aber die Sorge um diese Dinge ist – allgemein im ADHS-Diskurs – zu wenig weitsichtig und vor allem vorgeschoben, weil sie nicht nach Lösungen fragt, sondern Schuldige sucht.
«Wer ist Schuld?»
Diese Schuldfrage lenkt nicht nur von den Bedürfnissen Betroffener ab, sie stellt auch die grundsätzliche Validität von ADHS infrage. Statt zu fragen, wie man unterstützen kann, wird gefragt: Woher kommt das – und stimmt das überhaupt? Im Zentrum steht ein allgemeines Unbehagen gegenüber Menschen, die anders funktionieren. Menschen, die nicht konform sind, stören. Und es ist unbequem, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ADHS uns über die Gesellschaft und uns selbst verraten könnte. Dieses Unbehagen bleibt unausgesprochen zwischen den Zeilen, aber verschiebt das Subjekt der Sorge immer wieder. In diesem Fall: auf die Medikation und auf das Kindeswohl.
Nicht nur, weil es in diesen Diskussionen nie um Bedürfnisse geht, sondern weil sie wieder gestellt wird: Die Frage nach der Schuld, nach dem Auslöser eines Problems und eben oft auch dessen grundsätzlicher Validität. Nicht die Frage danach, ob es denn überhaupt zuvorderst um Schuld und Auslöser gehen muss. Und schon gar nicht die Fragen danach, wie man konkret und pragmatisch Unterstützung bieten kann und wie man auf längere Sicht mit dem Thema ADHS umgehen will. Denn das generelle Unbehagen gegenüber ADHS überwiegt. Das Unbehagen: Menschen, die «anders funktionieren» als die statistische Norm und oft nur als «Störer» auftauchen – und natürlich ist es auch unbequem, sich mit dem auseinanderzusetzen, was ADHS uns über unsere Gesellschaft und uns selbst verraten können. Dieses Unbehagen bleibt aber stets unausgesprochen zwischen den Zeilen – und verschiebt das Subjekt des Unbehagens und der Sorge immer wieder. In diesem Fall auf die Medikation und die Frage nach dem «Kindeswohl».
«Diese Schuldfrage lenkt nicht nur von den Bedürfnissen Betroffener ab, sie stellt auch die grundsätzliche Validität von ADHS infrage.»
Ein ähnlicher Mechanismus findet – erneut – in der aktuellen Debatte um das Thema Transidentität statt. Auch in dieser Diskussion wird das Kindeswohl instrumentalisiert – als Stellvertreter für das Unbehagen der Gesellschaft gegenüber trans Menschen und dem, was ihre Existenz über unsere Beziehung zu Gender offenbaren kann. Obwohl beispielsweise Hormonbehandlungen für trans Personen statistisch sehr sicher sind, bei Behandelten auf extrem hohe Zufriedenheit stossen und erwiesenermassen Suizide verhindern, stehen sie im Namen des Kindeswohls in letzter Zeit unter Dauerbeschuss. Ähnliches beim Sexualkundeunterricht für Kinder (der sexuellem Missbrauch nachweislich vorbeugt) oder Impfungen, etwa gegen Covid. Die Ironie ist dabei unübersehbar: Kinder werden als diskursiver Schutzschild missbraucht, gegen eben das, was sie eigentlich schützen würde. Wer sich tatsächlich um das Wohl von Kindern sorgt, hat sich umfassendere Fragen zu stellen als nur jene isolierten Fragen nach Medikamenten oder Social Media.
Die perfekte Lösung existiert nicht
Solche Kindeswohl-Debatten verpuffen nicht einfach, sie haben reale Konsequenzen. So wird in der Politik gerade über ein Verbot von geschlechtsangleichenden Massnahmen für trans Personen diskutiert, und das, obwohl diese Massnahmen in Wahrheit extrem wenige Menschen betreffen. Ein Verbot von Ritalin hingegen ist unrealistisch, dass sich die Bedingungen zur Verschreibung verändern, allerdings nicht. Die Wahrheit: Perfekte Lösungen existieren nicht.

Die Debatte um Ritalin gefährdet ihre überlebenswichtige Verfügbarkeit. (Bild: ChatGPT)
Geht es um Medikamente, müssen immer Abwägungen getroffen werden. Die vorgeschobene Angst um Kinder lenkt von den pragmatischen Fragen ab – und gefährdet obendrein eine Gesundheitsversorgung, die für Betroffene bisweilen überlebenswichtig ist. Denn: Wie drastisch die Konsequenzen einer plötzlichen Nichtverfügbarkeit von ADHS-Medikamenten für Betroffene sein können, kann man in entsprechenden Online-Communitys nachlesen – denn in letzter Zeit ist es immer wieder zu Lieferschwierigkeiten bei manchen Medikamenten gekommen. Es geht hierbei nicht einfach darum, dass «die Pille fehlt», sondern darum, dass ein zentrales Werkzeug zur Selbststeuerung plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Sich zu fragen, welche Rolle Medikation bei ADHS eine Rolle spielen soll, ist freilich sinnvoll. Aber nur, wenn die Frage aufrichtig und nicht etwa ein Ausweichmanöver ist. Und sowieso macht die Diskussion nur Sinn, wenn sie in einem grösseren Kontext gestellt wird – mit der nötigen Sensibilität und ohne Gesundheitsversorgung zu gefährden.
«Die Existenz individueller Strategien heisst nicht, dass der allgemeine Handlungsbedarf geringer ist.»
Wie sich die Diskussion um ADHS rund um das Thema Medikation und das Wohl von Kindern monopolisiert, führt nicht zuletzt auch dazu, dass Erwachsene mit ADHS immer wieder vergessen werden. So sehr, dass Sie als HR-Fachperson nun ein ganzes Kapitel über Ritalin und Kinder lesen müssen. Zwar haben die meisten Erwachsenen mit ADHS – sogar spät diagnostizierte – individuelle Strategien, der Druck, der auf ihnen im Kontext der Arbeitswelt lastet, ist aber dennoch nicht zu vernachlässigen, im Gegenteil. Nur, weil sich neurodivergente Menschen individuelle Strategien erarbeitet haben und dadurch am Arbeitsplatz nicht so sehr auffallen wie Kinder in der Schule, heisst das nicht, der allgemeine Handlungsbedarf geringer ist.
Die Debatte um Ritalin ist daher oft eine Stellvertreter-Diskussion. Im Zentrum stehen Ängste und gesellschaftliche Erwartungen, nicht die Bedürfnisse derjenigen, die mit ADHS leben.
Was dabei untergeht, sind die tatsächlichen Erfahrungen der Betroffenen selbst – auch, wie Medikamente in ihrem Alltag wirken, was sie leisten können und was nicht. Genau darüber sprechen wir im nächsten Kapitel.