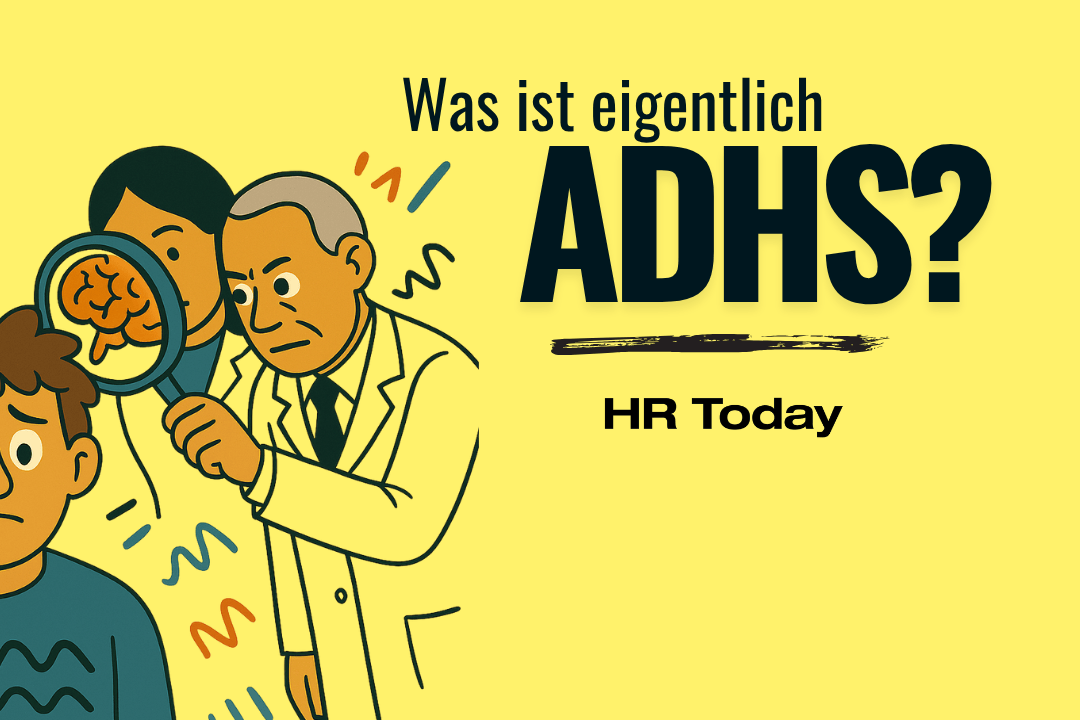Wer therapiert hier eigentlich wen?
Da Kind sitzt still da und kritzelt konzentriert in sein Matheheft. Niemand stört. Kein Chaos. Keine Zwischenrufe. Eltern und Lehrpersonen atmen auf. Moment, Eltern und Lehrpersonen?

In den letzten beiden Kapiteln ging es um falsche Debatten um ADHS – die Frage nach Fehldiagnosen, deren Ursachen, aber auch um den «Ritalin-Boom» im selben Zusammenhang. Ein Interview, das wir zitiert haben, stellt klar: Die Debatten zielen nicht auf eine Verbesserung der Lebensumstände von Menschen mit ADHS, sondern darauf, was diese – sowie ihr Umfeld, ihre Therapie oder die Forschung – womöglich falsch machen. Misstrauen als Leitmotiv.
Die Sommerserie im Überblick
Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun
Intro – Am Anfang war der Montag
Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos
Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: Die Lücke im Hirnscan
Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Gehirn – entpolitisiert
Kapitel 4 – Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind
Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt
Sie befinden sich hier: Kapitel 6 – Wer therapiert hier eigentlich wen?

Das Misstrauen, die Urteile und Vorwürfe gegenüber Menschen mit ADHS und der Umgang mit Diagnosen, der sie allein zur Sache der betroffenen Personen macht – wir haben bereits darüber geredet und werden es wieder tun – richten bei Betroffenen grossen Schaden an. Nicht nur das: Das Umfeld beeinflusst die Art und Weise, wie Betroffene sich selbst sehen und darauf, was sie unter ADHS verstehen. Das Umfeld definiert ADHS stets mit.
Das weiss auch Psycholinguistin Elena Maja Haegi. Sie ist Forscherin und Expertin zum Thema ADHS und Zweitspracherwerb, Lehr- und Lernstrategien – und selbst ADHSlerin und Autistin. Die Äusserungen der Jugendlichen und Kinder sind dabei konsternierend.
In ihrer Masterarbeit an der Universität Basel hält Haegi unter anderem die Auswirkungen eben dieser andauernden Vorwürfe fest:
«Die Jugendlichen haben oft das Gefühl, dass sie ‹kaputt› sind, bezeichnen sich selbst als ‹dumm›, fühlen sich von ihrem Umfeld ‹ins Lächerliche gezogen› und stark kritisiert». Diese Bezeichnungen stammen direkt von den betroffenen Kindern.
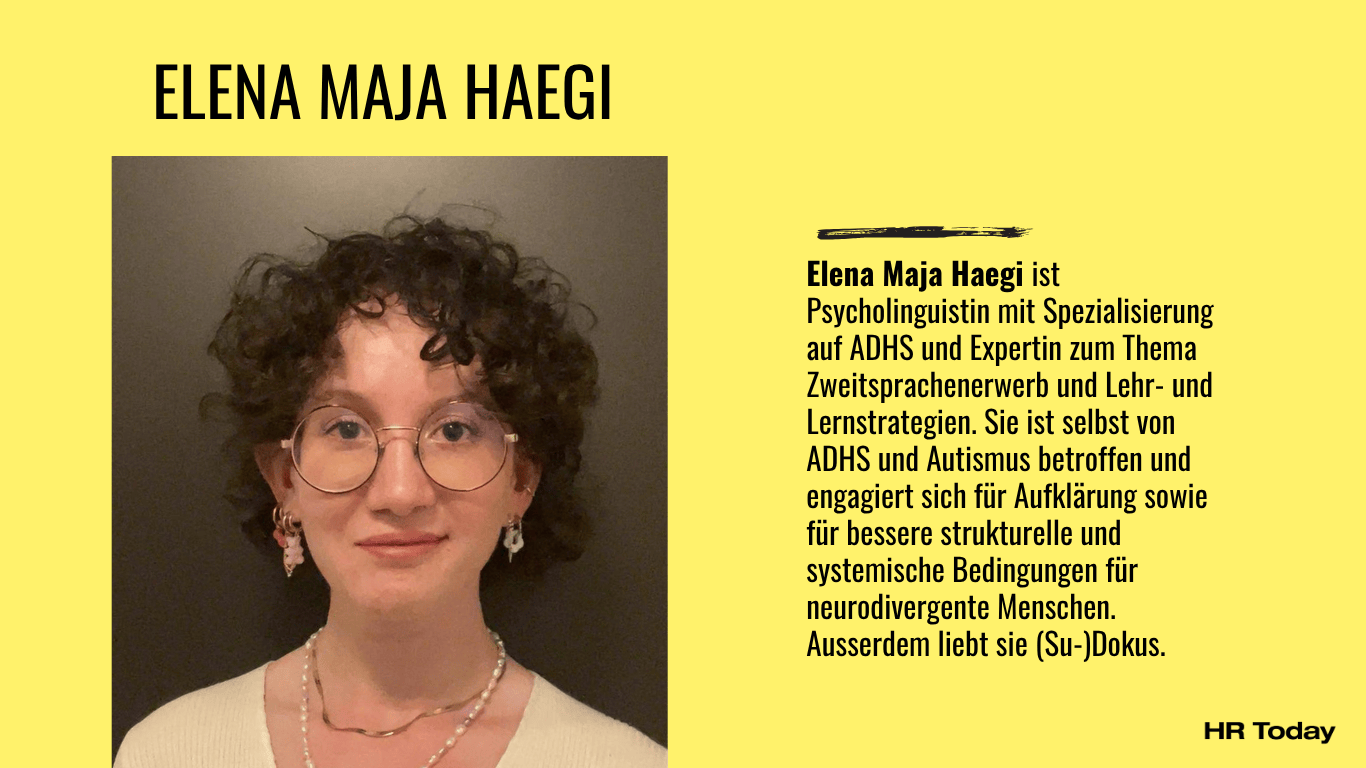
«Die daraus resultierenden Ängste, die Frustration, Scham und die negative Selbstwahrnehmung sind für sie eine grosse Belastung. Sie führen zu Demotivation, Lähmung, Erschöpfung, was vom Umfeld wiederum als Bestätigung für die Stigmatisierung wahrgenommen wird.»
Therapien und Medikation sind darum unerlässlich, um Betroffenen zu helfen. Dennoch zielen diese Massnahmen immer noch primär darauf ab, das Erleben und Verhalten der Betroffenen zu verändern.
Menschen mit ADHS und anderen Neurodivergenzen ecken also nicht nur sozial an und haben Schwierigkeiten mit Alltäglichkeiten, die «normalen» Menschen zwar insgesamt bekannt, aber in ihrer Intensität dennoch fremd sind. Nein, man gibt ihnen auch das Gefühl, sie seien selbst defekt und müssten repariert werden, eine Verantwortung, die man ihnen alleine aufbürdet.
Wer therapiert wen?
Der mit ADHS verbundene Leidensdruck entsteht aber eben nicht einfach durch die «Tatsache ADHS», sondern auch durch die Art und Weise, wie das Umfeld, ob Familie, Schule oder Arbeitsplatz, mit ihnen umgeht. Nicht wenige Betroffene fragen sich deshalb oft, ob es in Bezug auf Therapie und Medikation wirklich nur um ihr Wohl geht, oder auch darum, dass Andere besser mit ihnen klarkommen. Oder provokant: «Therapiere ich hier wirklich nur mich, oder vielleicht ein Stück weit auch mein Umfeld?». Auch das ist ein Motiv, das Elena Maja Haegi in ihrer Zusammenarbeit mit ADHS-Kindern immer wieder begegnet.
«Die Jugendlichen berichten mir, wie sie ihre ganze Energie dafür aufwenden, sich möglichst an die Ansprüche des Umfelds anzupassen und wenn dies – unvermeidlich – scheitert, sich erklären und rechtfertigen zu müssen», sagt Haegi.
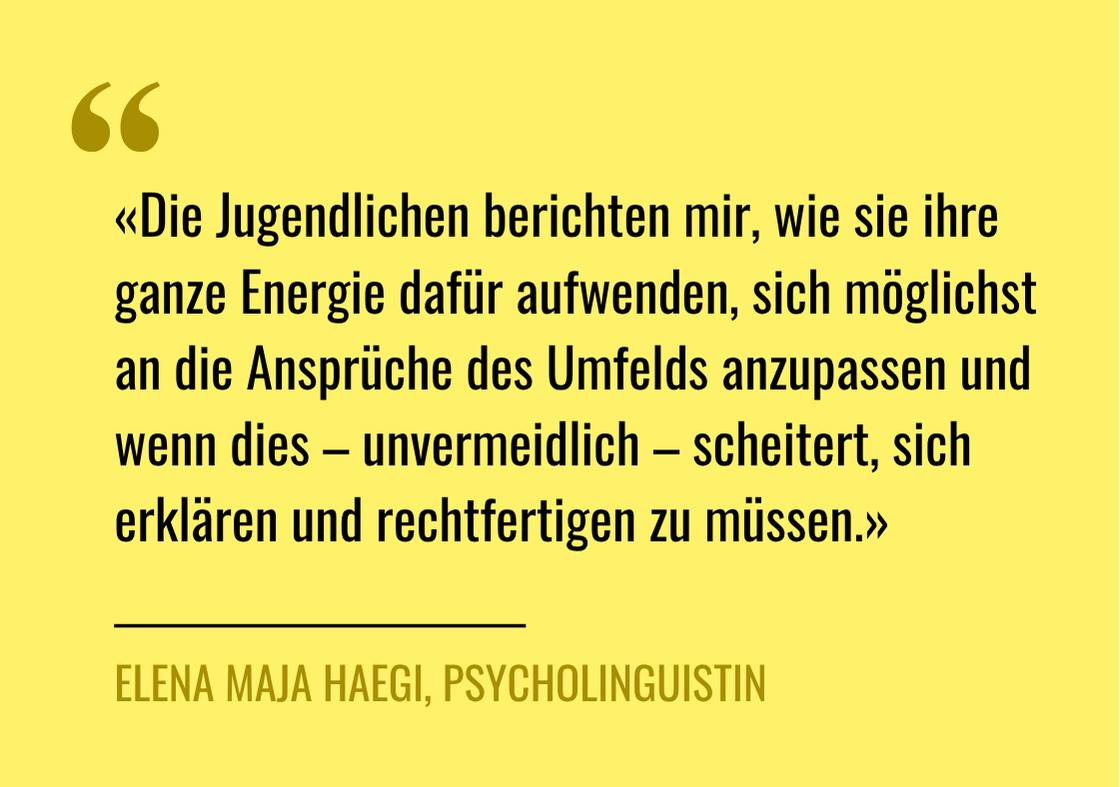
«Fast alle sind frustriert darüber, nicht ernst genommen zu werden und von Lehrpersonen und Eltern konstant für ‹unangemessenes› und ‹faules› Verhalten kritisiert und bestraft zu werden – Verhalten, das unfreiwillig und ungewollt ist und den Effort der Jugendlichen nicht widerspiegelt», so die Psycholinguistin.
Diese Umkehr ist hierbei weder ein rhetorischer Kunstgriff noch einfach so dahergesagt. James Swanson, Professor für Pädiatrie an der University of California, forscht zur Wirkung von ADHS-Medikation – und wurde kürzlich auch in einem vielbeachteten Artikel in der New York Times zitiert. Er hat dabei Erstaunliches entdeckt. Während es zwar absolut unbestritten ist, dass ADHS-Medikamente wirken, wirft seine Forschung die Frage auf, worauf sie tatsächlich abzielt. Denn Präparate wie Ritalin wirken sofort.
Äussere Reize werden unmittelbar abgeschirmt und in der Folge weniger intensiv wahrgenommen, Betroffene sind dadurch weniger ablenkbar und können sich plötzlich stundenlang konzentrieren. Selbst bei Aufgaben, die sich für Betroffene sonst sterbenslangweilig und unüberwindbar anfühlen. Kurz: Das, was – gerade bei Erwachsenen – viele Jahre, vielleicht das ganze Leben lang nur mit grosser Mühsal verbunden war, funktioniert endlich.
Ein Balance-Akt zwischen Innen und Aussen
Doch jetzt folgt die überraschende Wendung: Er hat festgestellt, dass Kinder unter Medikation nun stundenlang an ihren Mathehausaufgaben sitzen und sich auf Prüfungen vorbereiten können. Bessere Noten bleiben aber dennoch oft aus. Weiterführende Forschung hat schliesslich gezeigt: ADHSler, die Medikamente nehmen, können sich besser auf herausfordernde Aufgaben einlassen, doch gleichzeitig verschlechtern sich ihre Problemlösungsstrategien – ihre Herangehensweisen werden unstrukturierter, weniger flexibel, weniger kreativ.
Im Arbeitskontext könnte das in etwa so aussehen: Zwar kann sich der HR-Mitarbeiter den ganzen Tag in die Bereinigung einer Excel-Tabelle vertiefen, sortiert dabei aber alle Spalten manuell, färbt unnötig Felder ein, formatiert Schriften und fügt Formeln einzeln in jede Zelle ein,statt sie einfach per Klick auf das gesamte Datenfeld anzuwenden. Die Projektmanagerin kann nun zwar bis weit nach Feierabend am Pitchdeck für den wichtigen Kunden arbeiten, beginnt aber ohne klare Storystruktur und muss darum ständig Präsentationsfolien umplatzieren, verschiebt Logos pixelgenau, verändert die Schriftfarbe fünfmal und animiert Bulletpoints.
Damit wird ein weit verbreiteter Mythos in Frage gestellt: Menschen mit ADHS werden durch Medikation nicht automatisch effizienter und besser. Darum verschreiben viele Psychiater und Psychiaterinnen Stimulanzien nicht ohne damit einhergehende Therapie, in der sie Strategien lernen, um ihre Stärken und Schwächen besser steuern zu können.
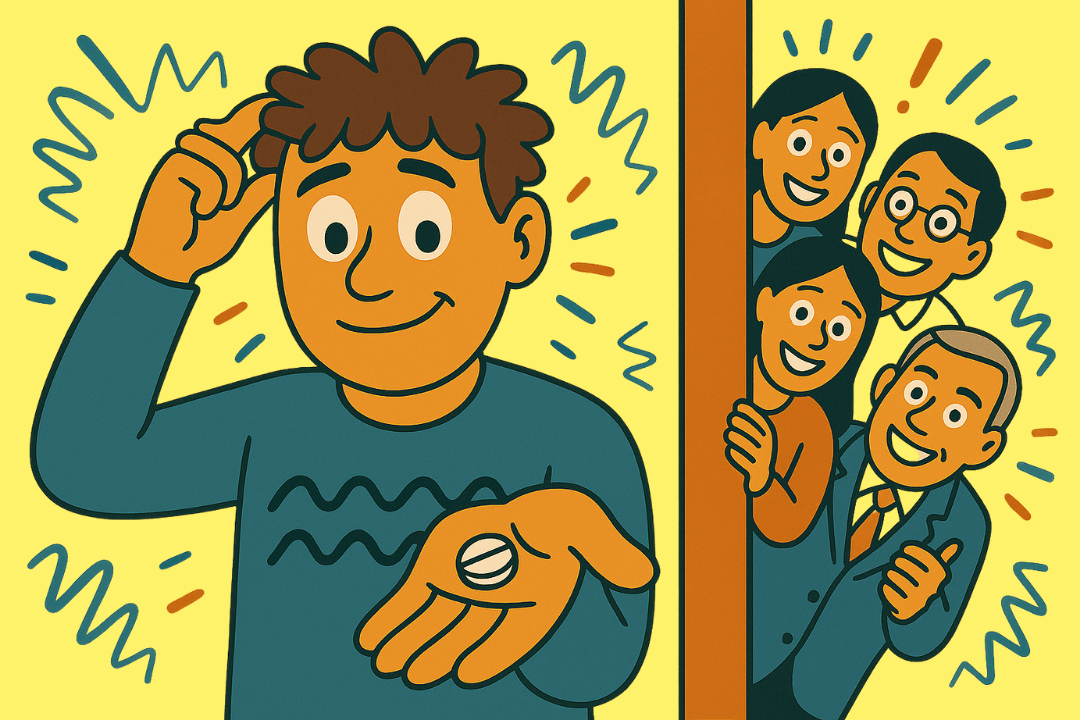
Manchen Betroffenen scheint es, Medikamente seien eigentlich nicht für Sie, sondern das Umfeld. (Bild: ChatGPT)
Der «Verdacht», dass mit ADHS-Medikamenten also nicht nur die betroffene Person selbst, sondern auch ihr Umfeld «therapiert» wird, erhärtet sich. Medikamente alleine beheben die Probleme im Zusammenhang mit ADHS also nicht. Sie ermöglichen es ADHSlern aber, sich so zu verhalten, wie es die Schule oder der Arbeitsplatz von ihnen verlangt. Sie sitzen still, lernen fleissig, halten sich an vorgegebene Zeiten, stören weniger, fallen weniger auf.
Das soll keine Herabwürdigung von Pharmakotherapie sein und auch keine Romantisierung – es soll aber zeigen, dass die Grenzlinien zwischen Innen und Aussen nicht so simpel sind, wie Alltagsweisheiten besagen. Die Frage, inwiefern man Menschen mit ADHS versucht mit Medikamenten für eine primär neurotypische Welt besser verdaulich zu machen, ist eine wichtige, sie darf aber auch nicht in den «Kinder werden mit Ritalin ruhiggestellt!»-Pathos umschwingen. Es muss – Stimmen von Betroffenen eingeschlossen – gesellschaftlich verhandelt werden, in was für einer Welt wir leben wollen und daraus Handlungsmöglichkeiten abzuleiten.
Medikation und Therapie – sprich der individuelle Umgang – mit ADHS, kann darum nicht das Ende der Debatte sein. Neurodivergente Menschen berichten immer wieder, dass sie sich wünschen, dass die Welt ihnen auch ein Stück weit entgegenkommt. Warum – und was genau – sie sich wünschen, erfahren Sie im nächsten Kapitel. Dort kommen Stimmen von Betroffenen zu Wort, die sich bei HR Today gemeldet haben. Telefonate, E-Mails – und sogar ein Gruppentreffen sind die Basis dessen, was Sie hier bald lesen werden.