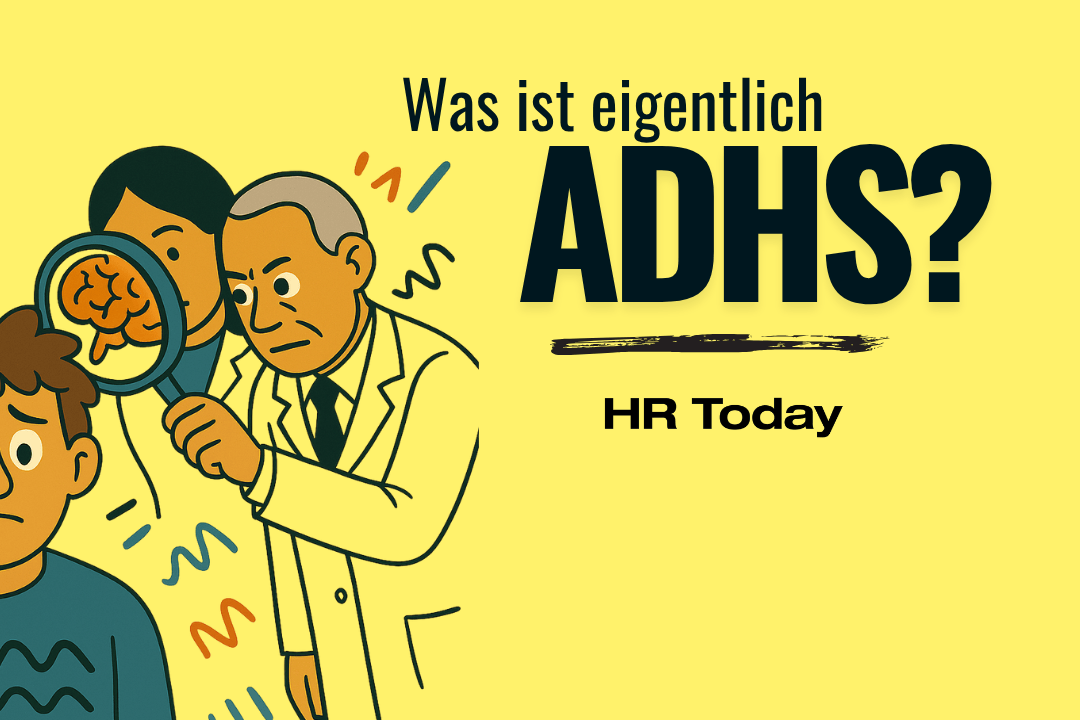Für alle, nicht für wenige
Die grosse ADHS-Serie von HR Today ist zu Ende. Abschliessende Gedanken – und Ratschläge – des Autors.

Die Sommerserie im Überblick
Die Ankündigung zur Sommerserie – und warum wir das tun
Intro – Am Anfang war der Montag
Kapitel 1 – Eine Geschichte mit Chaos über Chaos
Kapitel 2 – Von Hirnscans und Grenzfragen: Die Lücke im Hirnscan
Kapitel 3 – Privatsache Psyche? Das Gehirn – entpolitisiert
Kapitel 4 – Warum Fehldiagnosen nicht einfach Fehler sind
Kapitel 5 – ADHS im Fadenkreuz: Warum die Debatte über Ritalin in die Irre führt
Kapitel 6 – Wer therapiert hier eigentlich wen?
Kapitel 7 – «Warum lasst ihr mich nicht einfach so sein, wie ich bin?»
Sie befinden sich hier: Schlusswort – Was tun?
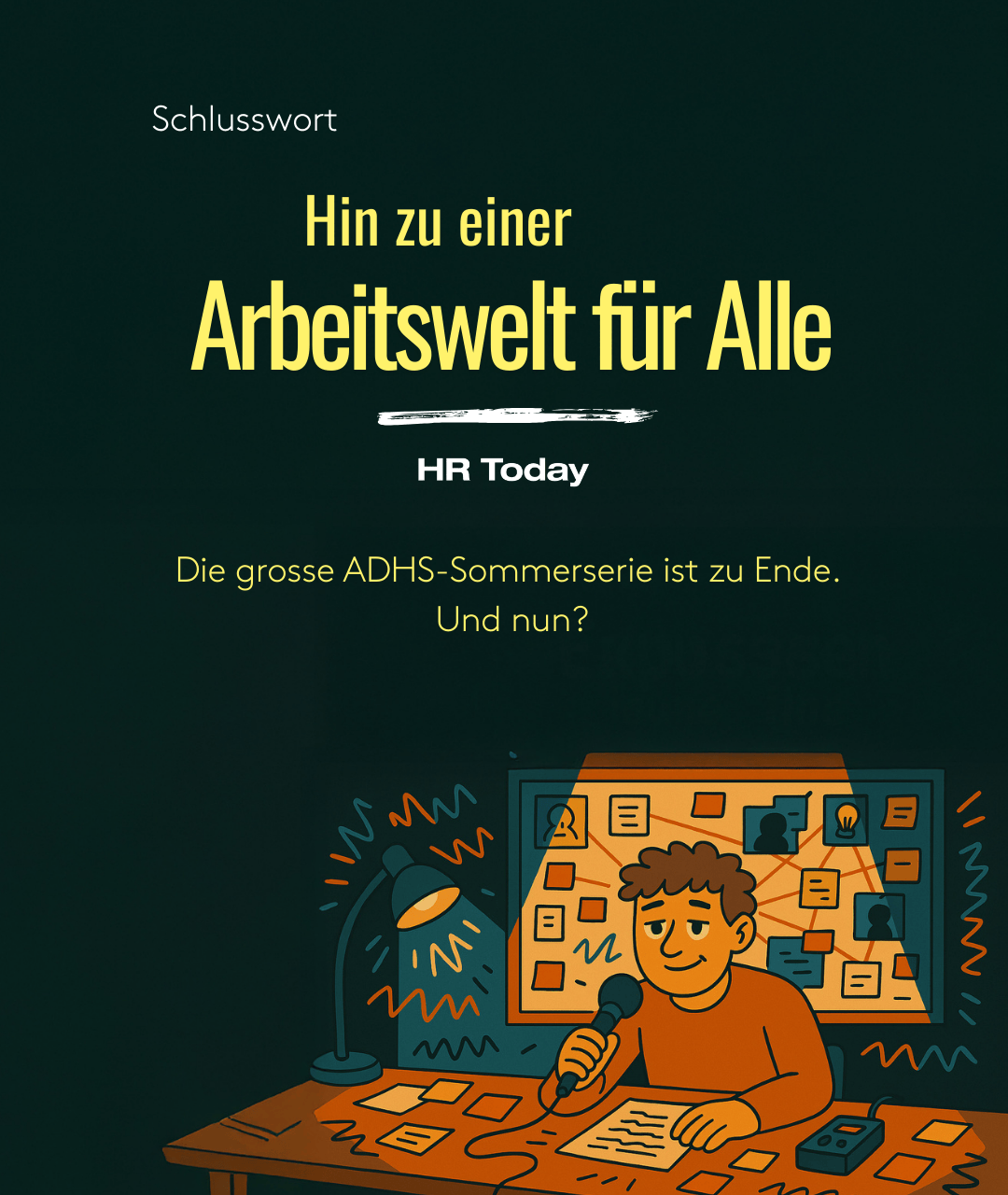
Liebe Lesende
Zunächst: Gratulation, dass Sie es bis jetzt durchgehalten haben – mir ist bewusst, der Stoff ist alles andere als leicht und umfassender, als man es gemeinhin erwarten würde. Darum auch: Danke.
Diese Serie gibt zwar kein Bulletpoint-Rezept zum Umgang mit ADHS und Neurodivergenz am Arbeitsplatz, aber sie liefert Grundlagen für HR-Professionals, um (Neuro-)Diversität im Arbeitsalltag anders zu denken. Vor allem: Nicht durch die Linse des Defekts, sondern durch die Linse von Bedürfnissen. Ganz grundsätzlich soll die Serie dadurch auch vermitteln, dass neurodivergente und neurotypische Menschen zwar anders funktionieren, im Kern aber gemeinsame Interessen haben – und dass es beide braucht und beide miteinander besser können, wenn sie aufeinander achten.
Als ich kürzlich in der sengenden Hitze an einem Fussgängerstreifen stand, dachte ich plötzlich: Man stelle sich vor, wir würden Fussgänger und Fussgängerinnen plötzlich durch die Defektlinse betrachten. Argumente gibt es genug: Können sie die Strasse nicht selbstverantwortlich überqueren? Dass man auf die Bedürfnisse von Fussgängern achten muss, führt zu einem verminderten Verkehrsfluss und das kostet Zeit, kostet Geld, kostet Infrastruktur und – Sie sehen, wie mangelhaft die Linse des Defekts selbst ist. Menschen in Autos und Menschen zu Fuss haben unterschiedliche Bedürfnisse, deren Vorteile auf der Hand liegen – und beide sind im Grunde immer noch Menschen.

Neurodivergente Menschen sind ebensowenig defekt wie Fussgänger und Fussgängerinnen. (Bild: ChatGPT)
Das ist aber genau die Schwierigkeit dieses Unterfangens: Verständlich zu machen, dass das Feststellen von Differenzen notwendig ist, um zu verstehen, welche Gemeinsamkeiten man hat. In gewisser Weise stellt diese Serie eine Leiter zur Verfügung, die man erklettern kann – und danach wieder umwerfen muss.
Wie sinnig ist es, Menschen in neurotypisch und neurodivers einzuteilen? Und ist diese binäre Einteilung am Ende nicht nur eine statistische Spielerei, deren Grenzziehung genau deshalb höchst vage ist? Nein und ja. Viele Menschen gehen – noblerweise – davon aus, dass Menschen im Grunde alle gleich sind, und in den meisten Fällen heisst das dann: wie sie.
Wir projizieren unsere eigene Art zu leben und funktionieren gerne auf andere Menschen, unterstellen ihnen, wie wir selbst zu sein und leiten daraus ab, wie wir sie bewerten – am Ende fällt dabei der Gedanke unter den Tisch, dass unsere Lebensrealitäten, Erfahrungen und Bedürfnisse signifikant voneinander divergieren können.
Es geht bei der Unterscheidung zwischen neurotypisch und neurodivers also darum, überhaupt erst sichtbar und verständlich zu machen, dass Menschen überhaupt unterschiedliche Bedürfnisse haben können, für deren Existenz es keine Rechtfertigung braucht. Sie können sich kaum vorstellen, wie verblüfft manche Menschen sind, wenn man ihnen diese vermeintliche Binsenweisheit zu vermitteln versucht.
Gleichzeitig müssen wir aber Acht darauf geben, aus Diagnosen nicht lediglich Tickets für «Spezialbehandlungen» zu generieren. Wir sollten sie stattdessen als Einladung verstehen, grundlegend über die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden nachzudenken. Denn womöglich entdecken wir dabei Dinge über uns selbst, über die Art und Weise wie unsere Gesellschaft funktioniert – Dinge, die vielleicht gar nicht, nicht mehr oder gar nie so richtig funktioniert haben.
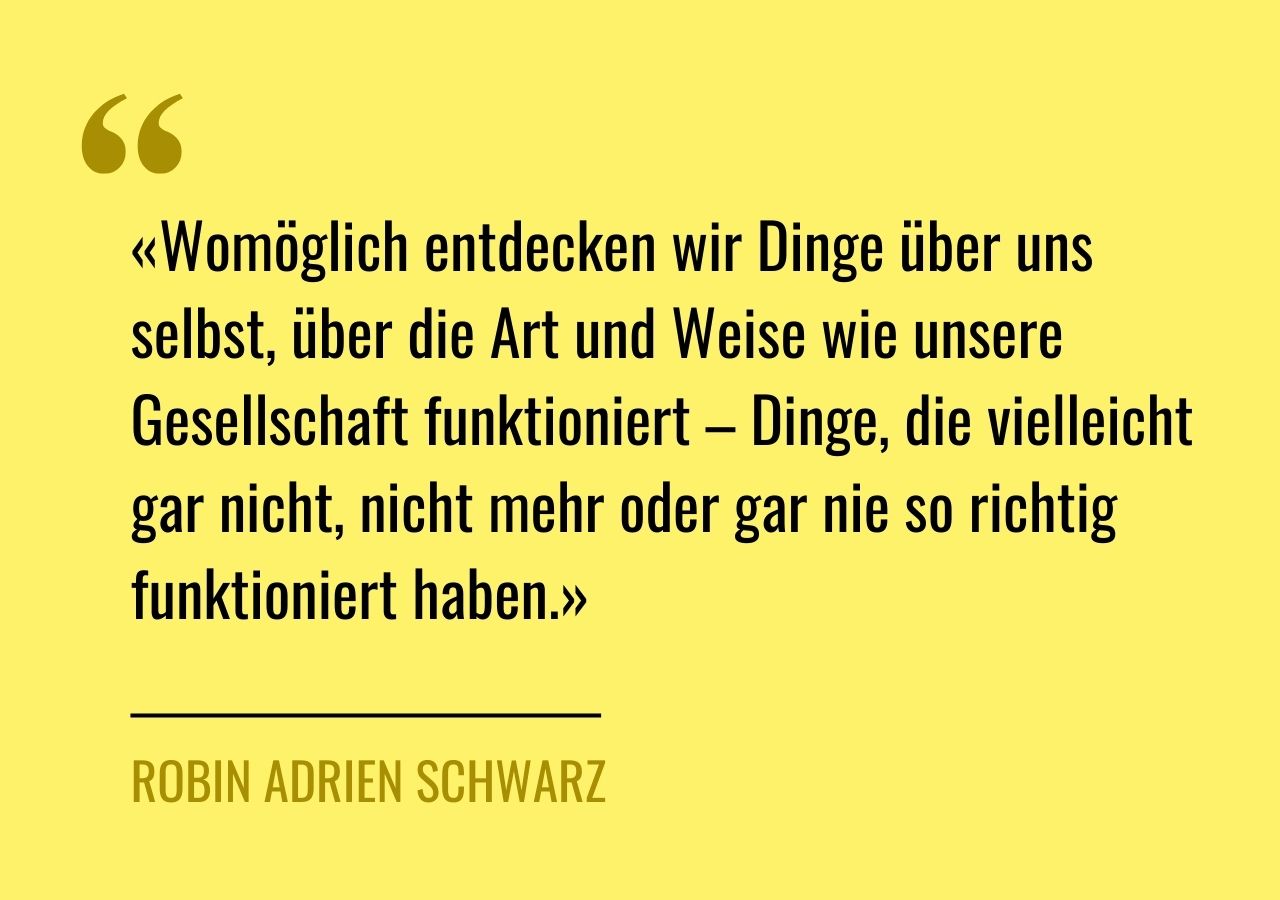
Angenommen, eine neurodivergente Person in Ihrem Unternehmen wünscht sich flexibleres Homeoffice und die Möglichkeit zu längeren Pausen. Was würden Sie tun, wenn sich danach eine andere Person beschwert und fragt, warum sie selbst keine längeren Pausen machen darf? Meine Antwort auf die Frage ist eine Gegenfrage: Ja, warum darfst du das eigentlich nicht? Es braucht keine Diagnose, um ein gerechtfertigtes Bedürfnis zu haben.
Wenn es jemandem dabei nützt, produktiv zu sein und die Arbeit so zu erledigen, wie es für sie am besten geht – was spricht denn dagegen? Gerechtigkeit ist kein Nullsummenspiel. Sie hilft uns, unsere Potenziale voll zu entfalten, mit Vorteilen für alle Seiten. Oder wie es der amerikanische Schriftsteller David Foster Wallace schrieb: «Die wirklich wichtige Freiheit bedeutet Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und Disziplin – und die Fähigkeit, sich aufrichtig um andere Menschen zu kümmern und immer wieder, in unzähligen kleinen, unspektakulären Weisen, für sie zu verzichten.»
Gerade im Rahmen der KI-Revolution heisst es vielerorts, HR stehe vor einem fundamentalen Wandel. Viele Stimmen betonen dabei, das Menschliche mehr ins Zentrum rücken zu wollen.
Ökonomisch wird die Beziehung zwischen Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden oft als Spannungsverhältnis verstanden, und das nicht zu Unrecht. Die HR-Abteilung ist dabei in einer Sandwichposition in der Mitte, in letzter Konsequenz ist sie aber – wenn sie nicht Teil davon ist – dem Willen der Geschäftsleitung unterstellt und geniesst darum nicht selten einen komplexen Ruf. Doch sie hat nun eine grosse Chance.
Am Ende sind es die Arbeitenden, die die Unternehmensstrategie in die Realität umsetzen – und in der modernen Arbeitswelt sind sie es, die am besten wissen, wie ihr konkreter Arbeitsalltag aussieht und was sie brauchen, um eben jene Unternehmensstrategie erfolgreich umsetzen zu können. Sind Bedürfnisse erfüllt, arbeiten alle besser. Das müssen HR-Abteilungen verstehen – und genug nahe an den Mitarbeitenden dran sein, um ihre Bedürfnisse zu verstehen. Denn diese Bedürfnisse sind – und enthalten – Informationen, die auch strategisch wertvoll sind.
Eine ADHS-Organisation, mit der ich mich ausgetauscht habe, erzählte mir, dass sich manchmal Führungspersonen melden, die von neurodivergenten Personen am Arbeitsplatz erfahren, und fragen, was sie tun sollen. Während diese Initiative natürlich löblich ist – und spezialisierte Organisationen auch viel Vermittlungsarbeit leisten können –, ist solchen Führungspersonen zu raten: Fragt sie. Fragt die neurodivergenten Personen – eigentlich: alle Personen –, was sie brauchen. Sie wissen es meistens selbst am besten.
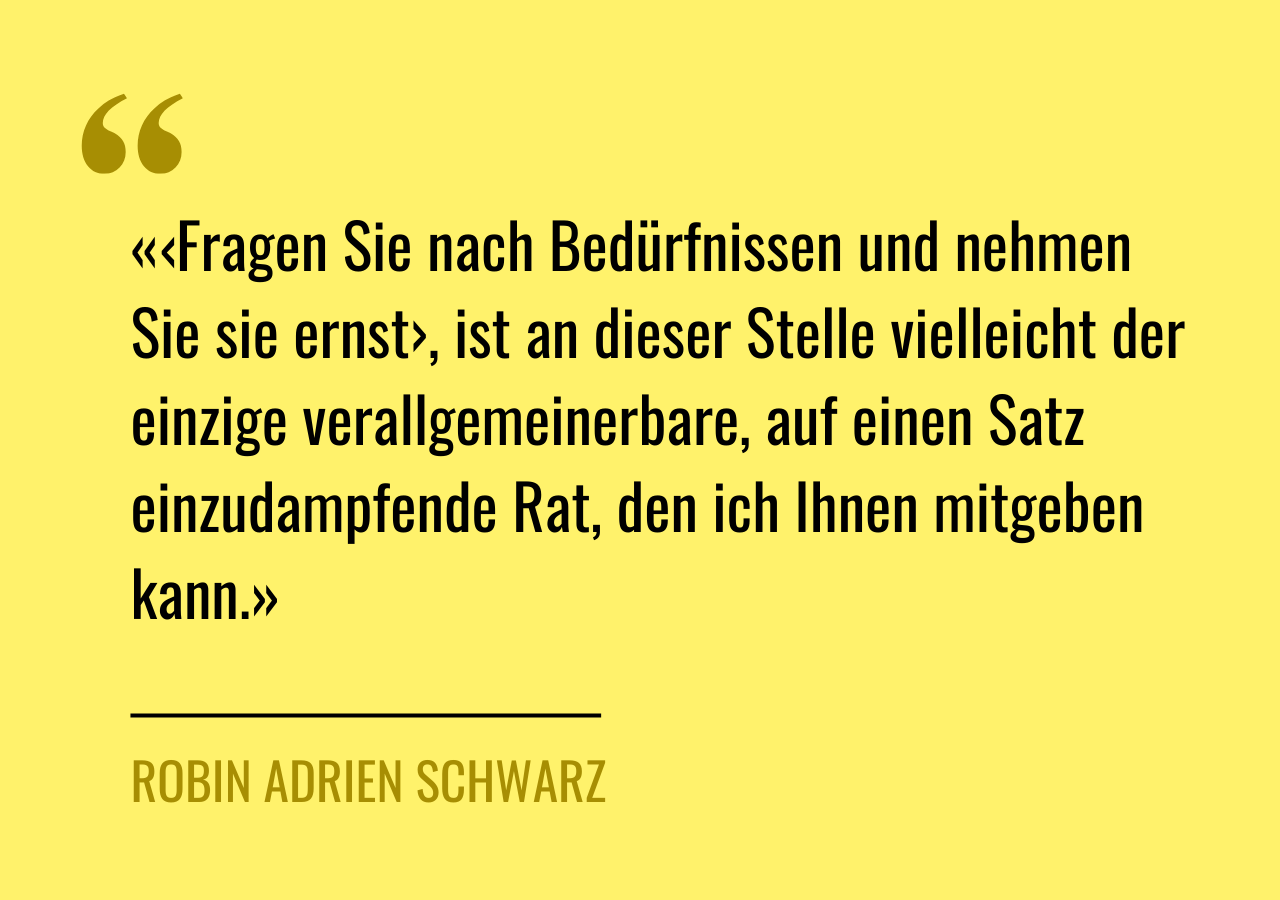
Einerseits sind persönliche Strategien per definitionem höchst individuell, andererseits haben neurodivergente Mitarbeitende vielleicht Ideen, um den ganz konkreten, von ihnen direkt gelebten Arbeitsalltag und die Firmenkultur für neurodivergente Menschen besser zu gestalten. «Fragen Sie nach Bedürfnissen und nehmen Sie sie ernst», ist an dieser Stelle vielleicht der einzige verallgemeinerbare, auf einen Satz einzudampfende Rat, den ich Ihnen mitgeben kann. Oder wie es Karpi im Interview formuliert: «Basic human decency» – grundlegender menschlicher Anstand. Was das allerdings für Sie und Ihr Unternehmen bedeutet, müssen Sie gemeinsam verhandeln und herausfinden.
Viele Menschen sind sich jedoch gerade im Arbeitsalltag nicht gewohnt, dass ihre Bedürfnisse eine Rolle spielen dürfen und man ihnen tatsächlich Platz einräumt. Darum sollten HR-Abteilungen proaktiv danach fragen und aufrichtig dazu einladen, offen zu sein. Wichtig hier: Es braucht dazu eine Vertrauensbasis und Räume, offen über Bedürfnisse und Gefühle sprechen zu können, ohne dass diese Information später gegen einen verwendet werden können, sei es beim Jahresgespräch oder in einer Lohnverhandlung.
Sie sehen – denken wir wirklich über Neurodivergenz nach, sind wir plötzlich mit ganz allgemeinen Fragen konfrontiert, die uns alle betreffen. Gerade in ökonomisch und politisch schwierigen Zeiten lohnt es sich, solche Fragen nicht auf morgen zu verschieben.
Outing am Arbeitsplatz?
Während ich diese Serie geschrieben habe, bin ich mit diversen Menschen – neurotypisch wie neurodivergent – ins Gespräch gekommen. Dabei wurden mir insbesondere von Menschen mit ADHS Fragen dazu gestellt, wie man sich am Arbeitsplatz am besten verhalten soll, ob es klug sei, sich zu outen. Dass neurodivergente Menschen sich davor scheuen, ihre Bedürfnisse am Arbeitsplatz mitzuteilen, muss HR-Fachpersonen hellhörig machen.
Ich kann selbst auf diese Frage – einmal mehr – keine einfache Antwort geben, denn, wie so oft: es kommt drauf an. Die Frage zeigt aber eine tiefere Dimension des Problemkomplex ADHS auf – und unterstreicht gleichzeitig die zentrale These dieser Essay-Reihe: ADHS ist keine rein medizinische Angelegenheit.
ADHS zeigt uns auf, wo wir an die unsichtbaren Grenzen der Gesellschaft stossen. Wir müssen uns alle – gemeinsam – ein paar wichtige Fragen stellen, was unser alltägliches Zusammenleben betrifft. Welche Bedürfnisse erachten wir als sozial akzeptabel und verträglich? Auf welche Bedürfnisse sollte ein Arbeitgeber acht geben, auf welche nicht – und weshalb? Welche Bedürfnisse sind in einem Unternehmen oder in der Schule überhaupt umsetzbar – und welche Zusatzressourcen braucht es dazu? All diese Dinge müssen wir zwingend verhandeln, wenn wir möchten, dass unsere Unternehmen zukunftsfähig bleiben – aber auch, weil wir es alle, als Menschen, verdient haben, ernst genommen zu werden. Schliesslich verbringen wir einen grossen Teil unseres Lebens mit Arbeit und jenen Menschen, die uns tagtäglich am Arbeitsplatz begegnen.

Manchmal muss man eine Leiter erklettern und dann umwerfen. (Bild: ChatGPT)
Wenn Menschen sich – ob hier, in dieser Serie oder am Arbeitsplatz – nicht outen möchten, obwohl sie es im Grunde gerne täten, hat das nichts mit Feigheit zu tun. Es ist Ausdruck ungleich verteilter Macht: Wer sich als neurodivergent outet oder öffentlich über eigene psychische Probleme spricht, kann sich damit Karrieremöglichkeiten verbauen, trotz aller der Entstigmatisierungsrhetorik, die in den letzten Jahren überall zu lesen und zu hören war. Tatsache ist: Wer auf Lohnarbeit angewiesen ist, überlegt sich lieber zweimal, sich als neurodivergent zu outen, weil wir Neurodivergenz eben als Defekt betrachten, der, so glauben viel zu viele, womöglich mit Risiken verbunden ist. Je privilegierter die Lage, desto sicherer ein Outing, je prekärer der sozioökonomische Status, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit auf negative Konsequenzen. Wir müssen also Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Menschen nicht fürchten müssen, sich selbst zu sein, mit allen Vor- und Nachteilen.
Für neurodivergente Menschen heisst das, sich gut zu überlegen, wem man sich wie mitteilt.
Für Personen in HR-Abteilungen heisst das: Begegnen Sie Menschen, die sich bei Ihnen outen mit Menschlichkeit und Verständnis. Fragen Sie nach Bedürfnissen. Drohen Sie nicht mit Konsequenzen und Formularen. Bieten Sie Raum. Hören Sie zu.
Von Verständnis, Empathie und Allianzen
Ein Motiv, das mir während der Arbeit an dieser Serie ebenfalls immer wieder begegnet ist: Menschen mit Neurodivergenzen möchten anerkannt, gesehen und verstanden werden. Nicht wenige fordern mehr Empathie – und auch diese Serie tut das. Kein Wunder, bei all den negativen Erlebnissen, die mit der eigenen Neurodivergenz verbunden sind. Kein Wunder, angesichts der Diskriminierung, die neurodivergente Menschen seit jeher erfahren haben.
An dieser Stelle zunächst etwas, was wie eine bittere Pille aussieht: Nicht alle Menschen sind fähig zu Empathie. Nicht alle Menschen erachten andere Menschen als gleichwertig. Nicht alle Menschen finden, dass es wichtig ist, Machtverhältnisse zu verschieben. Nicht alle Menschen empfinden es als notwendig, auf die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen zu achten.
Sich Verständnis und Empathie zu wünschen, ist nachvollziehbar. Dieser Wunsch kann aber auch zu einer Falle werden, die man sich selbst stellt. Externe Validierung – sich in anderen Menschen zu spiegeln – ist Teil des, nun, Menschseins. Aber gerade unterdrückte und diskriminierte Minoritäten müssen wissen, wann es Sinn macht, sie zu fordern und wann man einen Schlusspunkt setzen muss. Es gibt Menschen, die man nie davon überzeugen können wird, empathisch zu sein. Die eigene Wertigkeit von solchen Menschen abhängig zu machen – und oft sitzen solche Menschen an wichtigen Hebeln – ist eine Sackgasse.
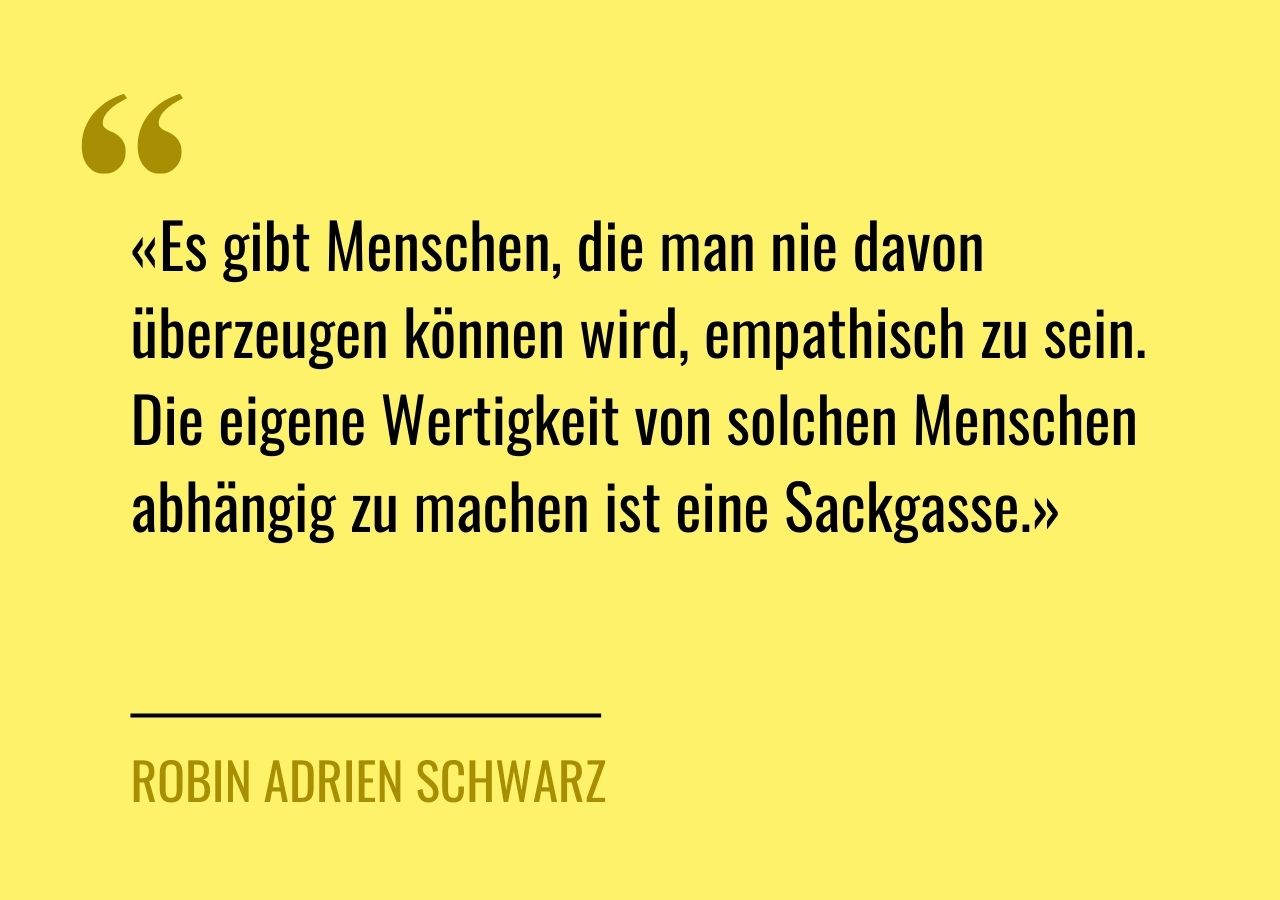
Stattdessen ist es ratsamer, Allianzen zu schmieden. Einerseits müssen sich neurodivergente Menschen stärker miteinander solidarisieren, andererseits müssen sie andere Menschen finden, die den Wunsch nach Gleichberechtigung teilen, egal, ob sie selbst von strukturellen Nachteilen betroffen sind. Realisiert man gleichzeitig, dass viele Gerechtigkeitskämpfe, die Minoritäten ausfechten müssen, miteinander verbunden sind und nach ähnlichen Logiken funktionieren, eröffnen sich eventuell noch breitere Möglichkeiten, Verbündete zu finden. Für neurodivergente HR-Profis kann das heissen: Den Kontakt zu anderen neurodivergenten HR-Profis suchen.
Zuletzt, und das ist eine rein persönliche Einstellung, die sich bei mir über die letzten Jahre hin entwickelt hat: Sich ständig in die Defensive zu begeben, die eigenen Bedürfnisse als nervig, als Bürde für andere, als zu rechtfertigen zu betrachten, bringt auf Dauer nichts. Wer sich ständig entschuldigt und um Erlaubnis fragt, sich selbst sein dürfen, zementiert die Linse des Defekts. Stattdessen sollten wir unsere Bedürfnisse als selbstverständlich betrachten und sie entsprechend selbstbewusst kommunizieren. Mein persönliches Umfeld ist sehr neurodivergent – und ich kenne so viele Menschen, die so viel zu bieten haben, obwohl sie nicht in ein klassisches soziales Gefüge passen. Oder vielleicht: Gerade deswegen. Sie denken out-of-the-box, sie sind kreativ, sprühen vor Ideen, sind agil, empathisch und sensibel, sind fähig, Muster zu erspähen, die anderen verborgen bleiben. Es ist schade, dass die Welt durch den ständigen Zwang, sich verstecken zu müssen, so viele wunderbare Menschen verpasst. Darum: Raus aus dem Schatten. Lasst die Welt an euch teilhaben. So wundersam und sonderbar wie ihr eben seid. Und ja: Zu sich zu stehen, braucht Mut.
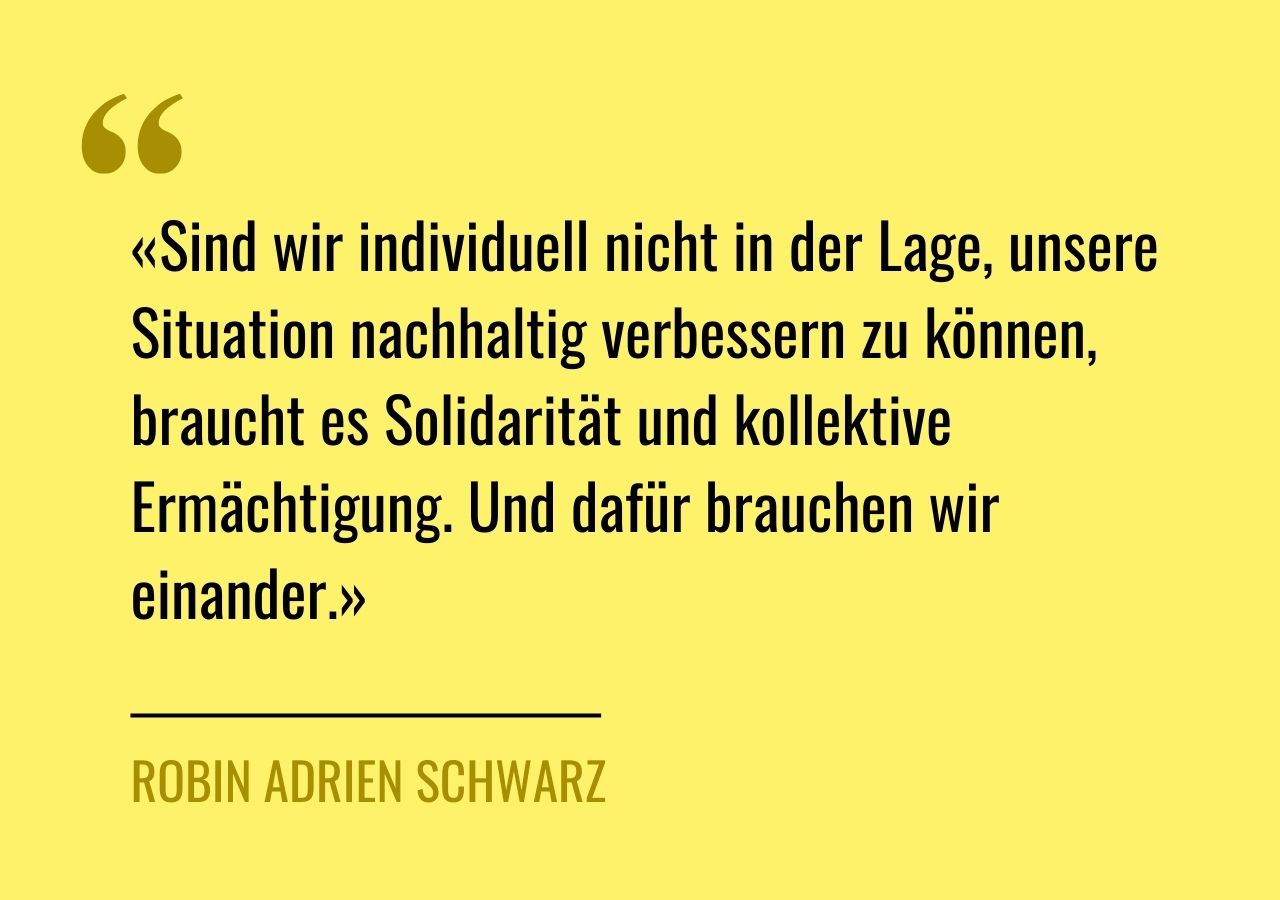
Ich bin kein Karriereberater – und ich möchte hier auch nicht als solcher verstanden werden. Dennoch scheint es mir in der Karriere ähnlich zu sein wie in Beziehungen. Zu Beginn einer Beziehung die eigenen Bedürfnisse zu verschleiern, nicht zu kommunizieren, wer man ist und wie man denkt, sich nur am Gegenüber zu orientieren und dessen Bedürfnisse zu befriedigen, während man hofft und wartet, erkannt zu werden, ist kein Rezept für eine nachhaltige Beziehung.
Dasselbe gilt am Arbeitsplatz. Ist ein Arbeitsplatz der richtige, wenn man nicht sich selbst sein kann, wenn man sich verstecken muss, wenn man Bedürfnisse dergestalt unterdrücken muss, bis man ein Burnout erleidet – und der Arbeitgeber sich trotzdem immer noch nicht dafür interessiert, was er ändern könnte? Wohl kaum. Gleichzeitig ist das keinesfalls ein Aufruf dazu, dass sich alle neurodivergente Menschen am Arbeitsplatz outen sollen.
Wie bereits erwähnt: Es sind auch nicht alle Menschen in der privilegierten Lage, sich überhaupt outen oder einfach den Job wechseln zu können. Genau hier werden wieder die Allianzen wichtig: Sind wir individuell nicht in der Lage, unsere Situation nachhaltig verbessern zu können, braucht es Solidarität und kollektive Ermächtigung. Und dafür brauchen wir einander.
Denn gemeinsam geht es immer besser als alleine.